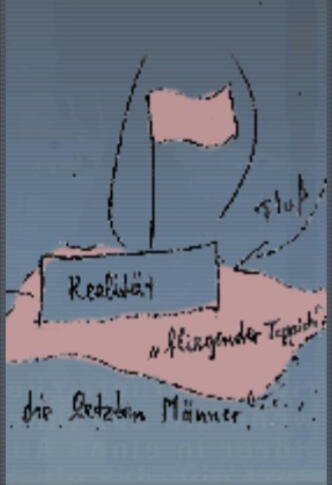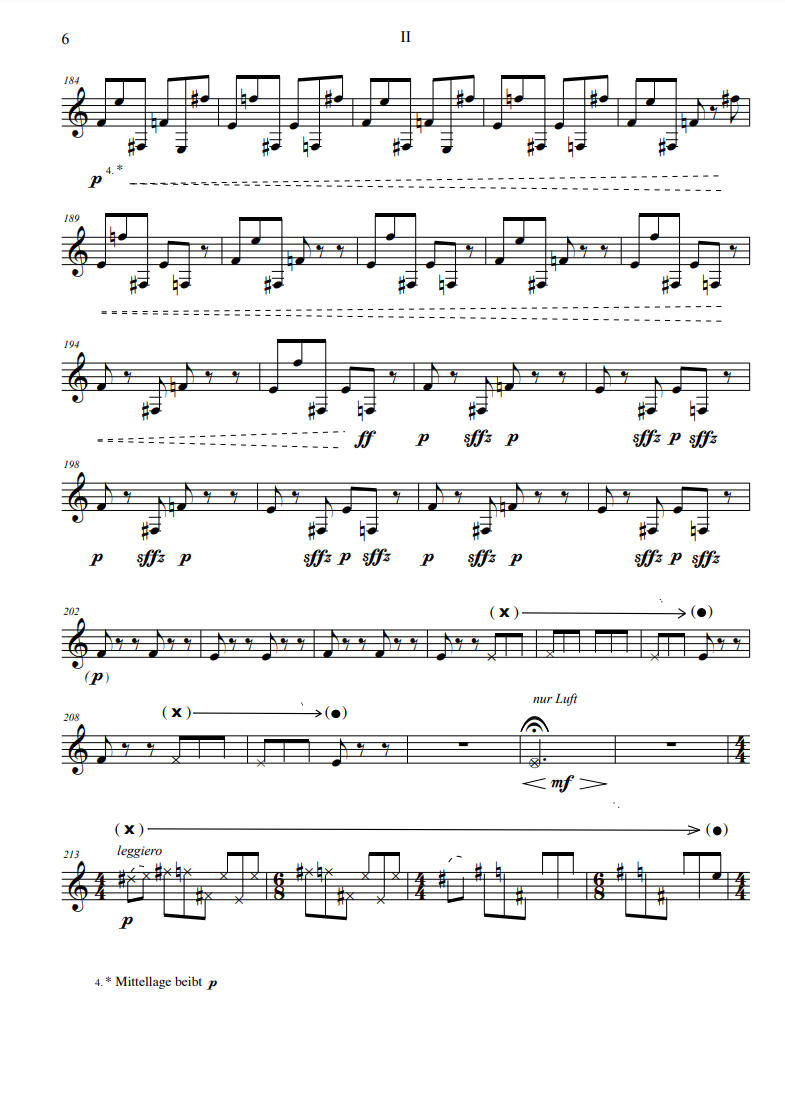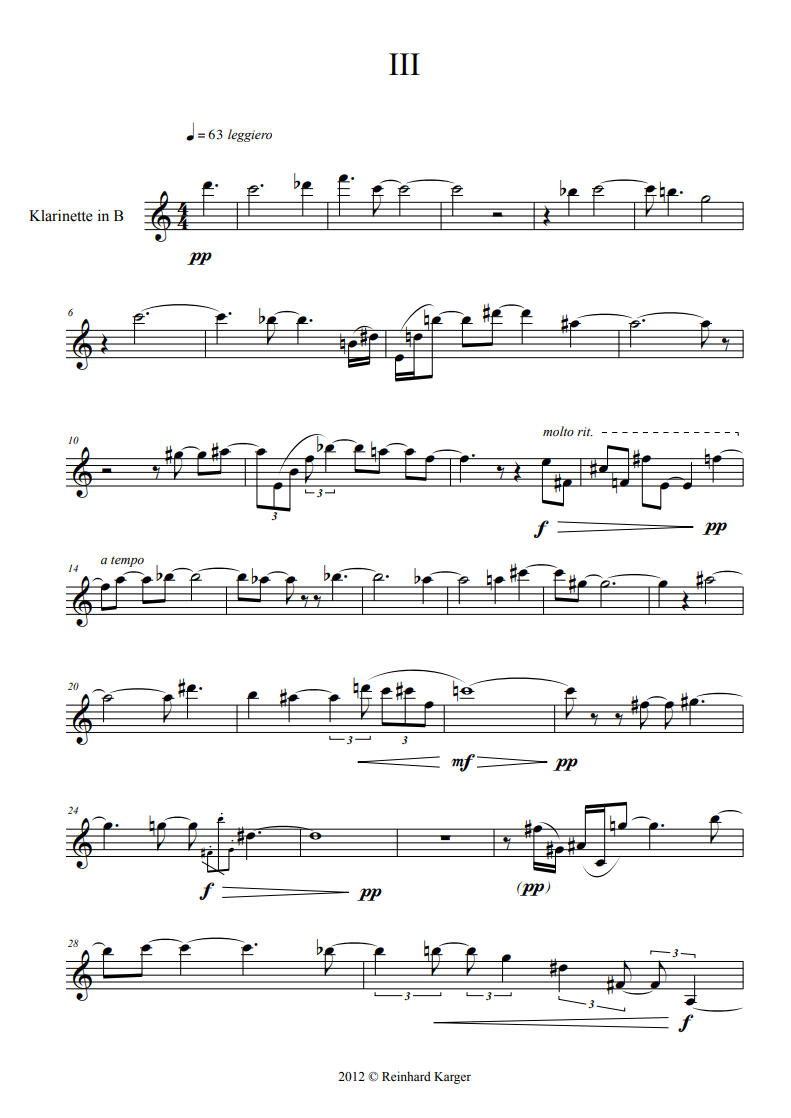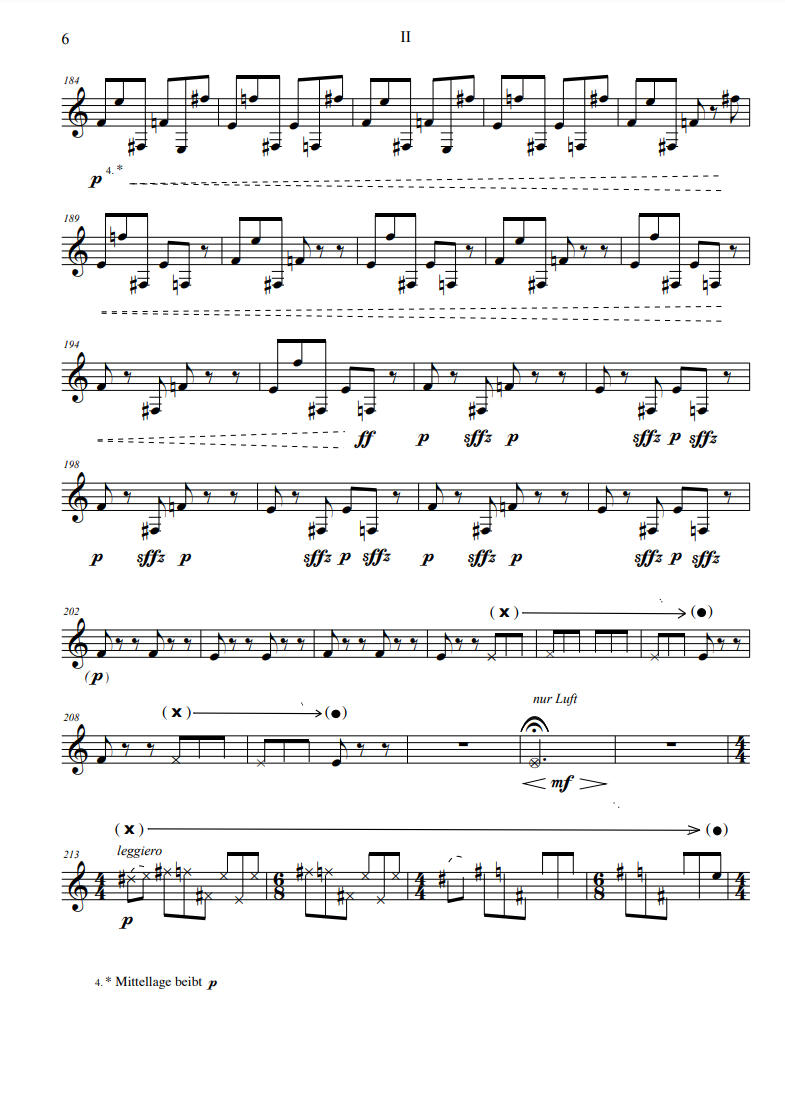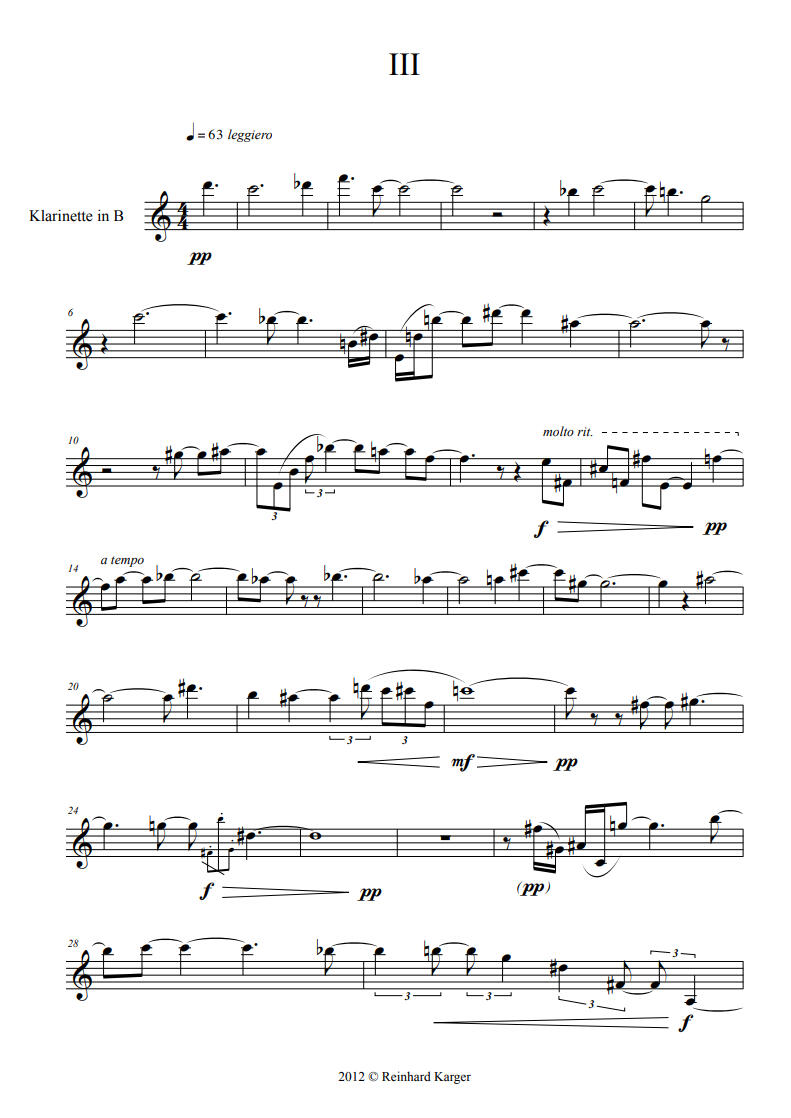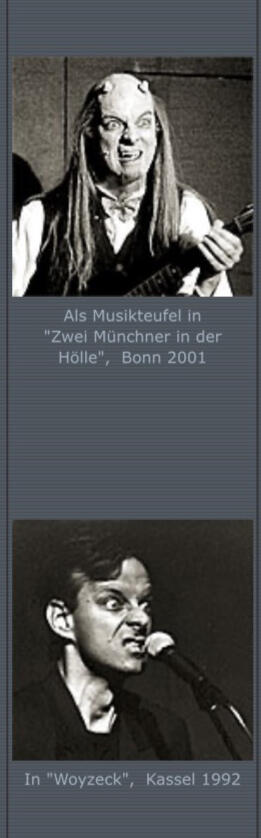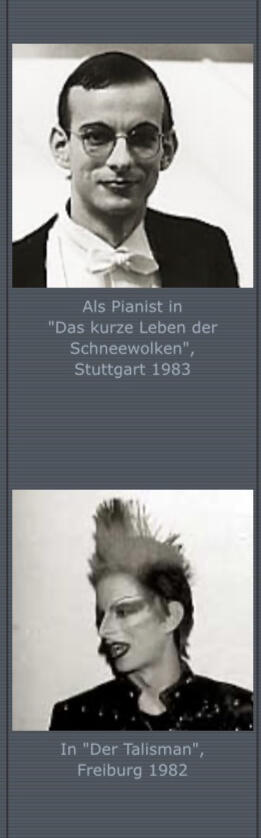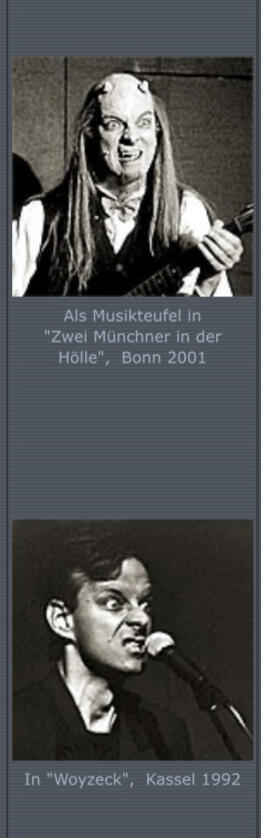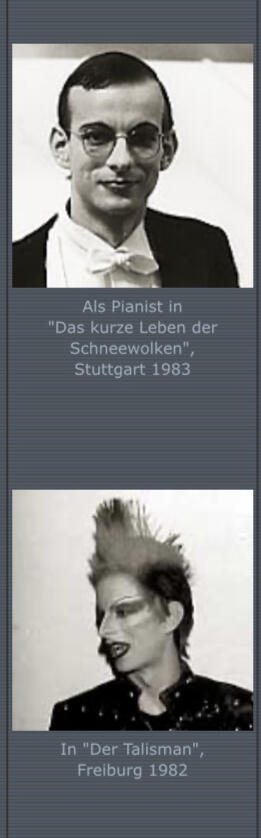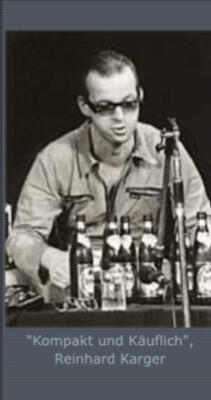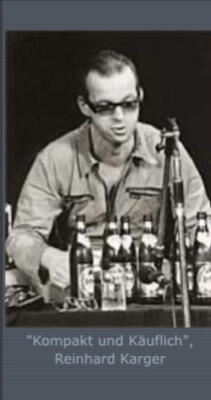Reinhard Karger
Komposition Regie Projekte
Home
Meine musikalischen Forschungen hätten dann ihr Ziel erreicht,
wenn die aus ihnen hervorgehenden Produkte den geneigten Hörer
in einen Ausnahmezustand verführen könnten – einen Zustand, der gleichermaßen von "Zugreifen" und "Loslassen" geprägt ist:
die paradoxe Einheit von höchster Wachsamkeit und tiefem Fallenlassen – den Zustand, der allein das ästhetische Abenteuer ermöglicht ...
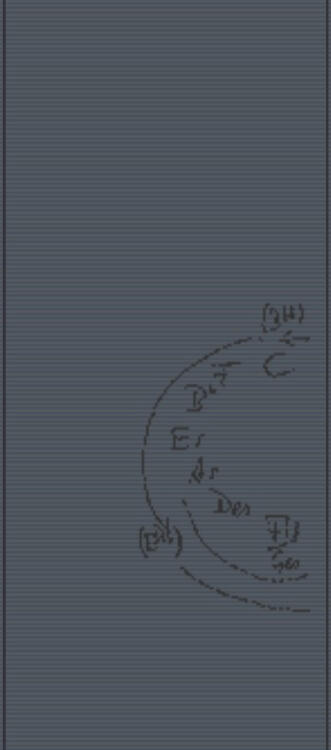
Home
My musical research would achieve its goal if the emerging products would seduce my listeners into a state of exception – a state that is characterized by activity and relaxation at the same time: the paradoxical unity of awareness and letting go – this state that solely enables aesthetic adventure ...2016-01-13 Reinhard Karger
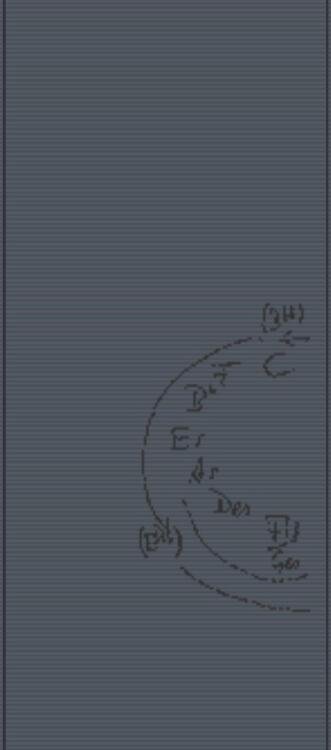
Compositions
wie die zeit vergeht
seven short pieces for violin solo
2024/25
Landschaft 2024 (Version von „Alphabet 87“ - for Morton Feldman) for 14 violins
2024
video on youtube link below
abseits
With text fragments from the novel „ Lenz“ by Georg Büchner
Hörstück 2023
Das Schweigen
On a text fragment from „Der Bauernfänger“ by Franz Kafka
Hörstück 2023
Raskolnikoffs Traum
(nach F.M. Dostojewski)
Hörstück
2022
Raskolnikoff
(nach F.M. Dostojewski)
Hörstück
2022
Die Heimkehr
(nach Friedrich Hölderlin)
Hörstück
2021
keiner weiß was
Hörstück
2020
als ich am späten nachmittag allein
(nach Marcel Proust)
Hörstück
2020
fremd
fremd
(nach Franz Kafka)
Hörstück
2020
bei tag und nacht
(nach Franz Kafka)
Hörstück
2020
Die güldne Sonne
für Di, Sheng, Violine, Violoncello und Klavier
2019/20
Lost and Found
for Ensemble (11 instruments)
1) Vertigo
2) Uncle Neil
3) Early
4) My old Shoes
5) Fake News
6) Late
complete recording on soundcloud.com
2018/19
wie ist die welt so stille
for soprano solo and five-voice women's choir dedicated to Traudl Schmaderer und Voceterna
2016
come closer
three movements for Pipa and String Quartet details
dedicated to Huikuan Lin and the Pacific Quartet Vienna 2014/15
This is the show
(based on a text by Samuel Beckett)
(for soprano and double bass clarinet)
2014
An Joseph Roth
(version for trombone)
for trombone
2014
vielleicht wüßten wir (maybe we knew)
based on a text by Joseph Roth)
for violoncello and playback
2013
An Joseph Roth
for clarinet
2011/2012
Der blinde Spiegel (the blind mirror)
for string quartet (dedicated to Joseph Roth)
2011
complete recording on soundcloud.com
nec sine te nec tecum
for soprano, flute and guitar
2007
Sie saß in der Nachmittagssonne und rauchte
(smoking in the afternoon sun) HörprobeDetails
for clarinet, piano and vibraphone
2006
complete recording on soundcloud.com here
mes adieux – for Wolfgang Stryi
for clarinet and piano
2005
complete recording on soundcloud.com here
Die späte Welt (the late world)
seven pieces for mixed choir, soprano, mandoline and double bass
2004–2006
complete recording on soundcloud.com here
Dieses obskure Objekt der Begierde
(this obscure object of desire)
eight miniatures for soprano
2003
Gold und Silber (gold and silver)
for alto saxophone and organ
2002
Ein Fallen im Wind (falling in the wind)
fragment for voice and string quartet
2002
the penrose piano book of pentatonic secrets
for piano
2000/01
complete recording on soundcloud.com here
Komm, o Tod, du Schlafes Bruder
(come, o death, you brother of sleep) HörprobeDetails
HörprobeDetails
for mixed choir
1998/99
complete recording on soundcloud.com here
La Vie c'est Ailleurs – Hommage à Marcel Proust (life is elsewhere)
for soprano and ensemble
1996–98
complete recording on soundcloud.com here
Wandlung in Es (mutation in E-flat)
for brass band
1995
Walk softly
for five clarinets
1994/95
Die Sieben Winde (the seven winds)
phantome canon for flute and playback
1993/94
Rag Khammaj
instrumentation for sarod und orchestra
1991
Stau (traffic jam)
for ensemble
1990
Mit geschlossenem Munde zu singen (humming)
for mixed choir
1989
Guten Tag, haben Sie zwanzig Minuten Zeit?
(Hello, do you have twenty minutes?)
for Fl, Ob, Kl, Vl, Va, Vc, Db
1989
Tod. Richtkraft.
three Hölderlin-fragments for Mezzosoprano, Vl, Va, Vc and playback
1988
Auf der Milchstraße wieder kein Licht
(again no light on the milky way)
for male voice, 2 Saxes, Git, Klav, Perc., Tr, Tromb.
based on poems by Rolf Bossert
1988
Alphabet 87 (für Morton Feldman)
for violin
1987/88
complete recording on soundcloud.com here
KadenzTanz (cadence dance)
for bass clarinet
1986
Findling (foundling)
for piano
1985
Deutsche Reste Nr. 1 (german leftovers nr. one)
for chamber orchestra
1984
Mein Schneckenhaus – Fühler raus! (my snailhouse)
for 4 voices, 4 instruments and playback
1982–83
Durchbruch (breaking through)
for 2 choirs, 6 solo voices, tr, tromb. and 2 perc.
1979
Mein Schneckenhaus – ein unfertiges Stück
(my snailhouse – an unfinished piece)
for ensemble
1977
Schattenformen (shadows)
for two choirs and playback
1975/76
Emomatsch
tape collage
1975
Kompositionen
wie die zeit vergeht
sieben kurze stücke für violine solo
2024/25
Landschaft 2024 (version of „Alphabet 87“ - for Morton Feldman) für 14 Violinen
2024
Video link auf Youtube (siehe unten)
abseits
Mit Textfragmenten aus der Erzählung „ Lenz“ von Georg Büchner
Hörstück
2023
Das Schweigen
Über ein Textfragment aus „Der Bauernfänger“ von Franz Kafka
Hörstück
2023
Raskolnikoffs Traum
(nach F.M. Dostojewski)
Hörstück
2022
Raskolnikoff
(nach F.M. Dostojewski)
Hörstück
2022
Die Heimkehr
(nach Friedrich Hölderlin)
Hörstück
2021
keiner weiß was
Hörstück
2020
als ich am späten nachmittag allein
(nach Marcel Proust)
Hörstück
2020
fremd
fremd
(nach Franz Kafka)
Hörstück
2020
bei tag und nacht
(nach Franz Kafka)
Hörstück
2020
Die güldne Sonne
für Di, Sheng, Violine, Violoncello und Klavier
2019/20
Lost and Found
für Ensemble (11 Instrumente)
1) Vertigo
2) Uncle Neil
3) Early
4) My old Shoes
5) Fake News
6) Late
Komplette Einspielung auf soundcloud.com hier
2018/19
wie ist die welt so stille
für Sopran solo und fünfstimmigen Frauenchor
Traudl Schmaderer und Voceterna gewidmet
2016
come closer
für Pipa und Streichquartett
Huikuan Lin und dem Pacific Quartet Vienna gewidmet
2014/15
This is the show
(nach einem Text von Samuel Beckett)
für Sopran und Kontrabassklarinette
2014
An Joseph Roth
(Version für Posaune)
für Posaune solo
2014
vielleicht wüßten wir
(mit einem Text von Joseph Roth)
für Violoncello solo und Zuspielung
2013
An Joseph Roth
für Klarinette solo
2011/2012
Der blinde Spiegel
Streichquartett (für Joseph Roth)
2011
Komplette Einspielung auf soundcloud.com
nec sine te nec tecum
für Sopran, Flöte und Gitarre
2007
Sie saß in der Nachmittagssonne und rauchte
für Klarinette, Klavier und Vibraphon 2006
mes adieux – für Wolfgang Stryi
für Klarinette und Klavier
2005
Komplette Einspielung auf soundcloud.com
Die späte Welt
sieben geistliche Stücke für gemischten Chor,
Solosopran, Mandoline und Kontrabass
2004–2006
Komplette Einspielung auf soundcloud.com
Dieses obskure Objekt der Begierde
acht Miniaturen für Sopran solo 2003
Gold und Silber
für Altsaxophon und Orgel 2002
Ein Fallen im Wind
Fragment für Stimme und Streichquartett
2002
the penrose piano book of pentatonic secrets
für Klavier solo
2000/01
Komplette Einspielung auf soundcloud.com
Komm, o Tod, du Schlafes Bruder
für achtstimmigen gemischten Chor 1998/99
Komplette Einspielung auf soundcloud.com
La Vie c'est Ailleurs – Hommage à Marcel Proust
für Sopran und Ensemble
1996–98
Komplette Einspielung auf soundcloud.com
Wandlung in Es
für großes Blasorchester
1995
Walk softly
für 5 Klarinetten
1994/95
Die Sieben Winde
Phantomkanon für Flöte und Playback
1993/94
Rag Khammaj
Instrumentation für Sarod und Orchester
1991
Stau
für Ensemble
1990
Mit geschlossenem Munde zu singen
für gemischten Chor
1989
Guten Tag, haben Sie zwanzig Minuten Zeit?
für Fl, Ob, Kl, Vl, Va, Vc, Kb
1989
Tod. Richtkraft.
Drei Hölderlin-Fragmente für Mezzosopran,
Vl, Va, Vc und Tonband
1988
Auf der Milchstraße wieder kein Licht
für Männerstimme, 2 Sax, Git, Klav, Schl, Tr, Pos
zu Texten von Rolf Bossert
1988
Alphabet 87 (für Morton Feldman)
für Violine solo
1987/88
Komplette Einspielung auf soundcloud.com
KadenzTanz
für Baßklarinette solo
1986
Findling
für Klavier solo
1985
Deutsche Reste Nr. 1
für Kammerorchester
1984
Mein Schneckenhaus – Fühler raus!
für 4 Stimmen, 4 Instrumente und Tonband
1982–83
Durchbruch
für 2 Chöre, 6 Solosänger, Tr, Pos und 2 Schl
1979
Mein Schneckenhaus – ein unfertiges Stück
für Ensemble 1977
Schattenformen
für zwei Chöre und Tonband
1975/76
Emomatsch
Tonbandcollage
1975
come closer
– three movements for Pipa and String Quartetdedicated to Huikuan Lin and the Pacific Quartet Vienna
2014/15This piece tries to explore touching points between eastern and western musical languages, to state distance and to develop intimacy very much like in human relations, where real closeness is only possible through respect for the differences that seperate us.It is a personal musical comment on globalization and wants to nourish hope that we can get along together.Reinhard Karger
2015
wie die zeit vergeht
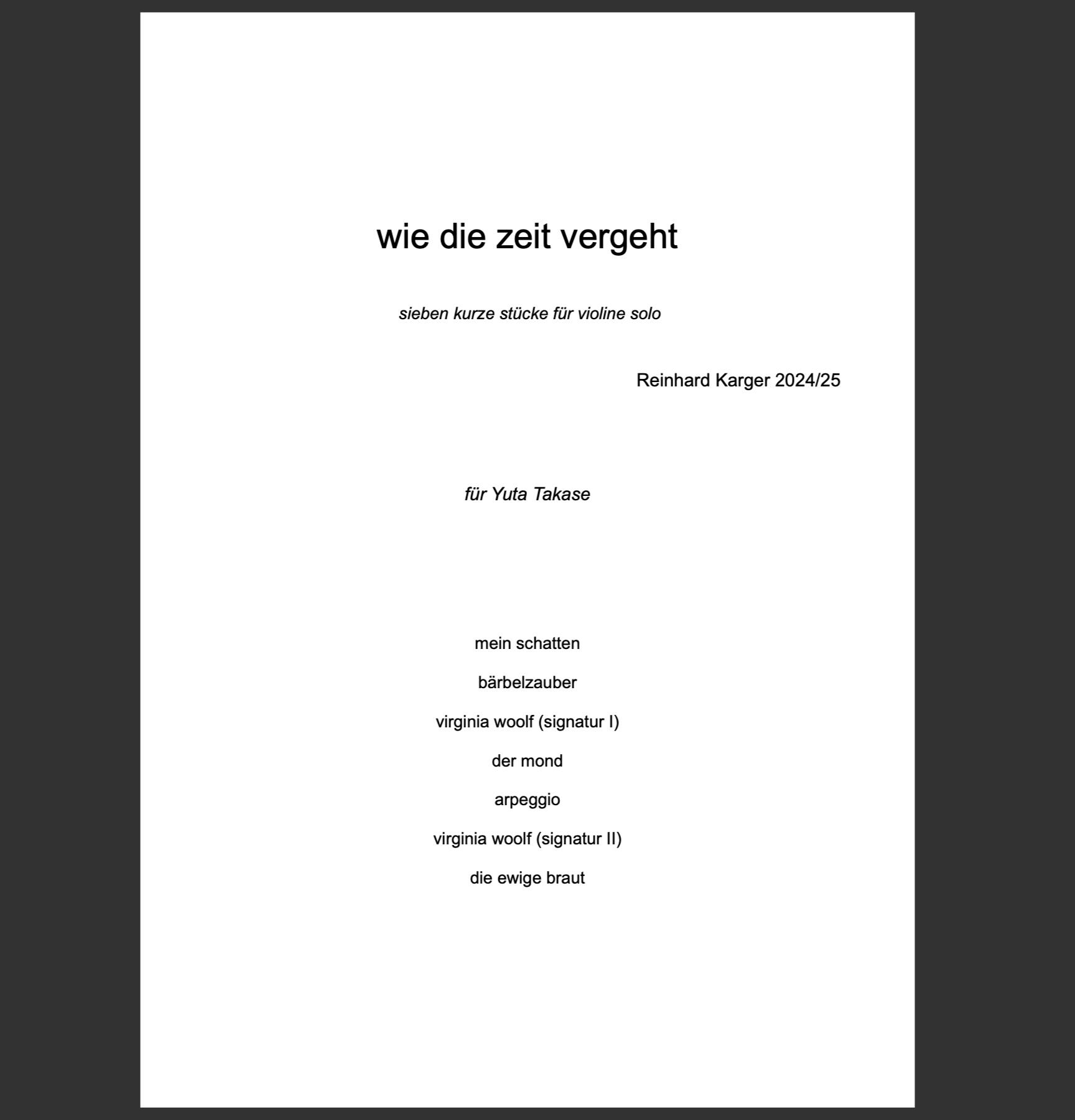
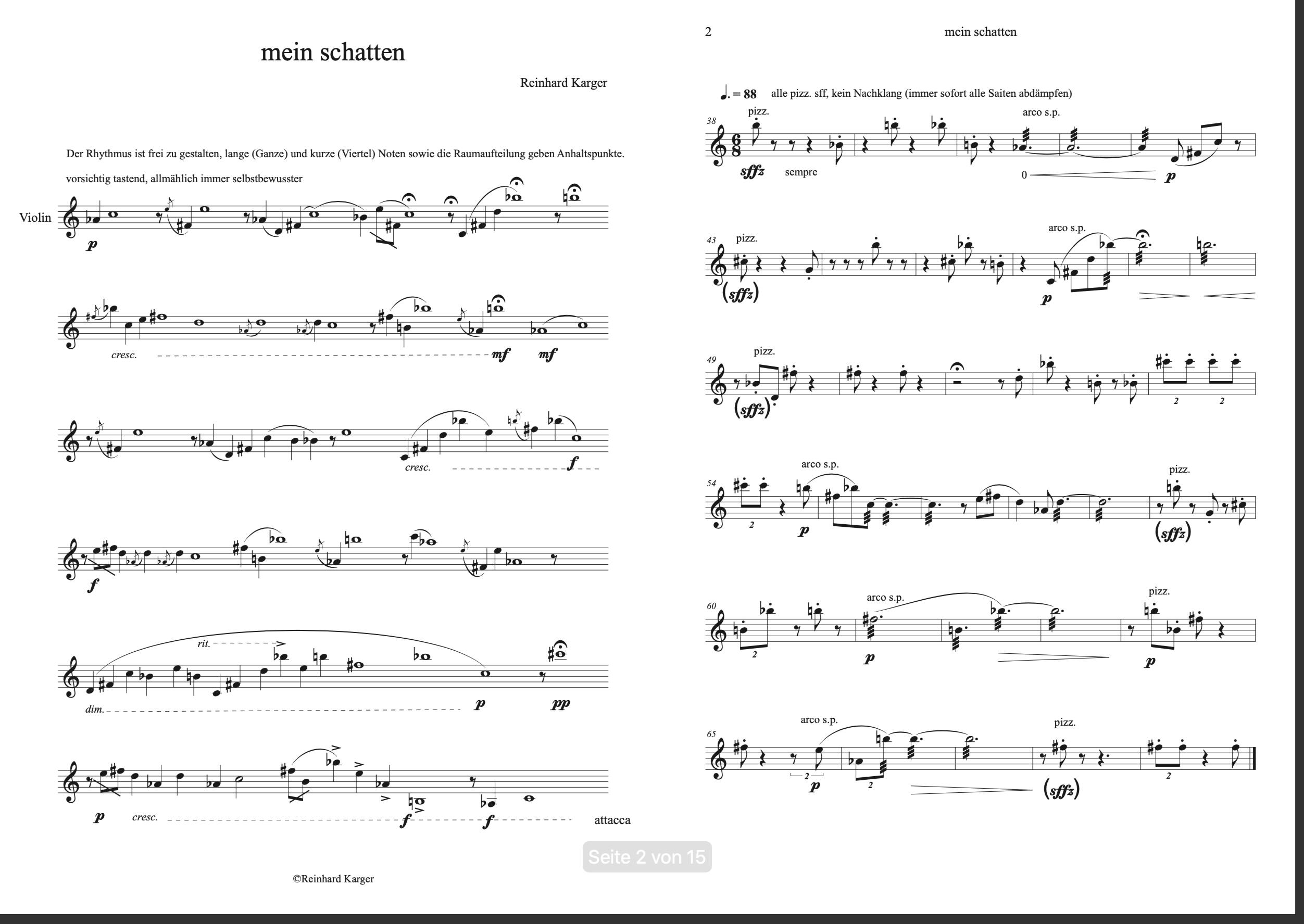
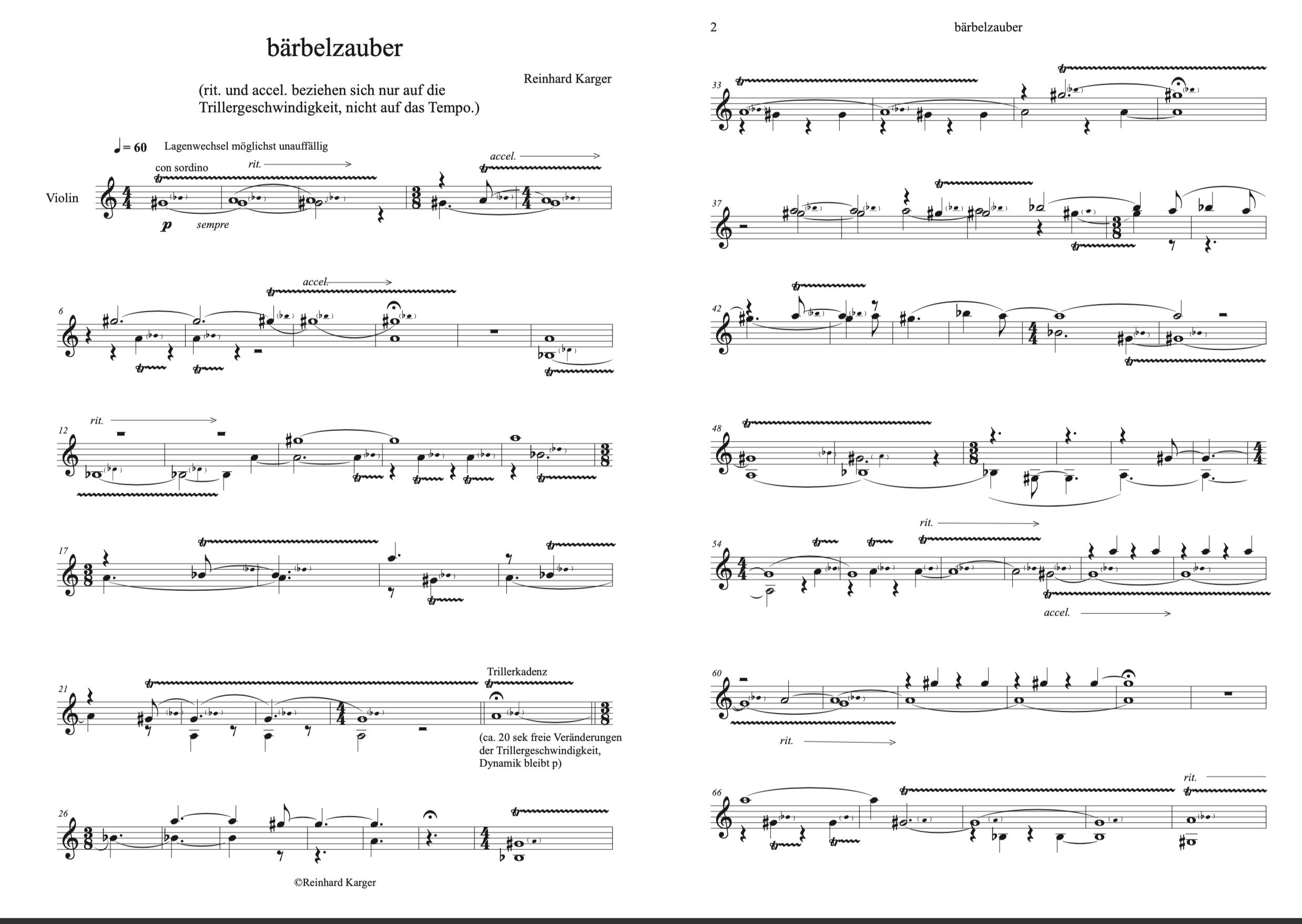
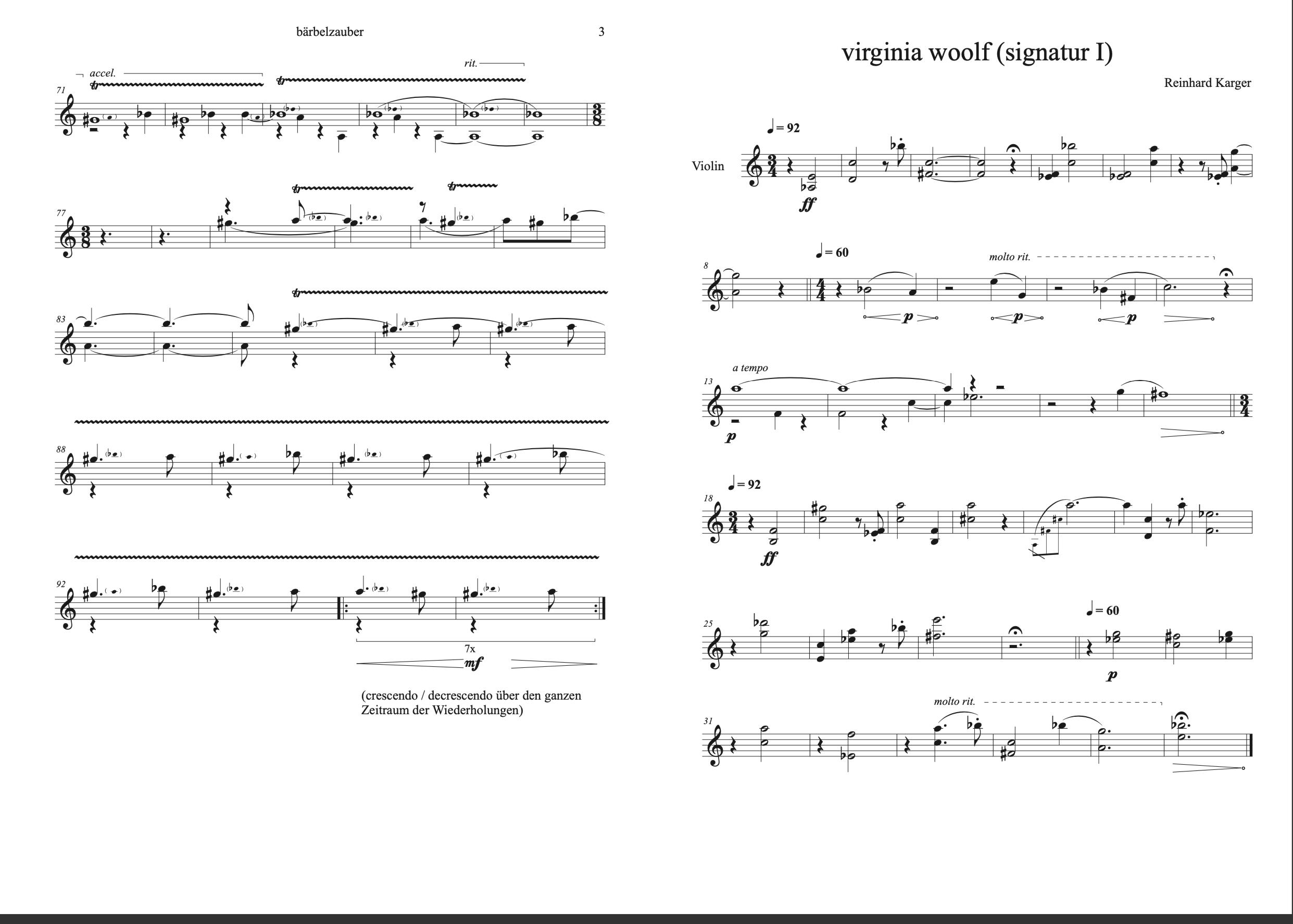
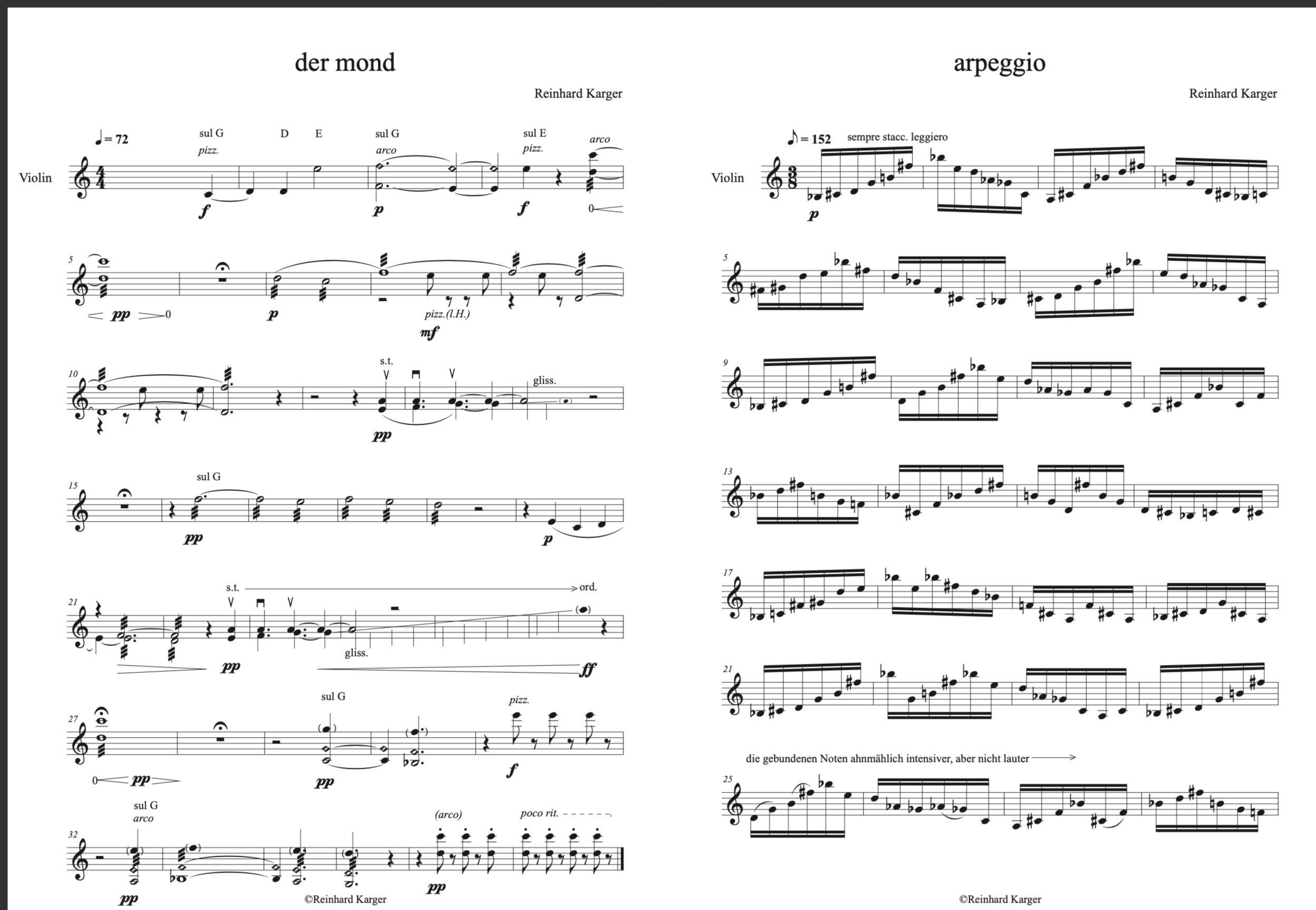
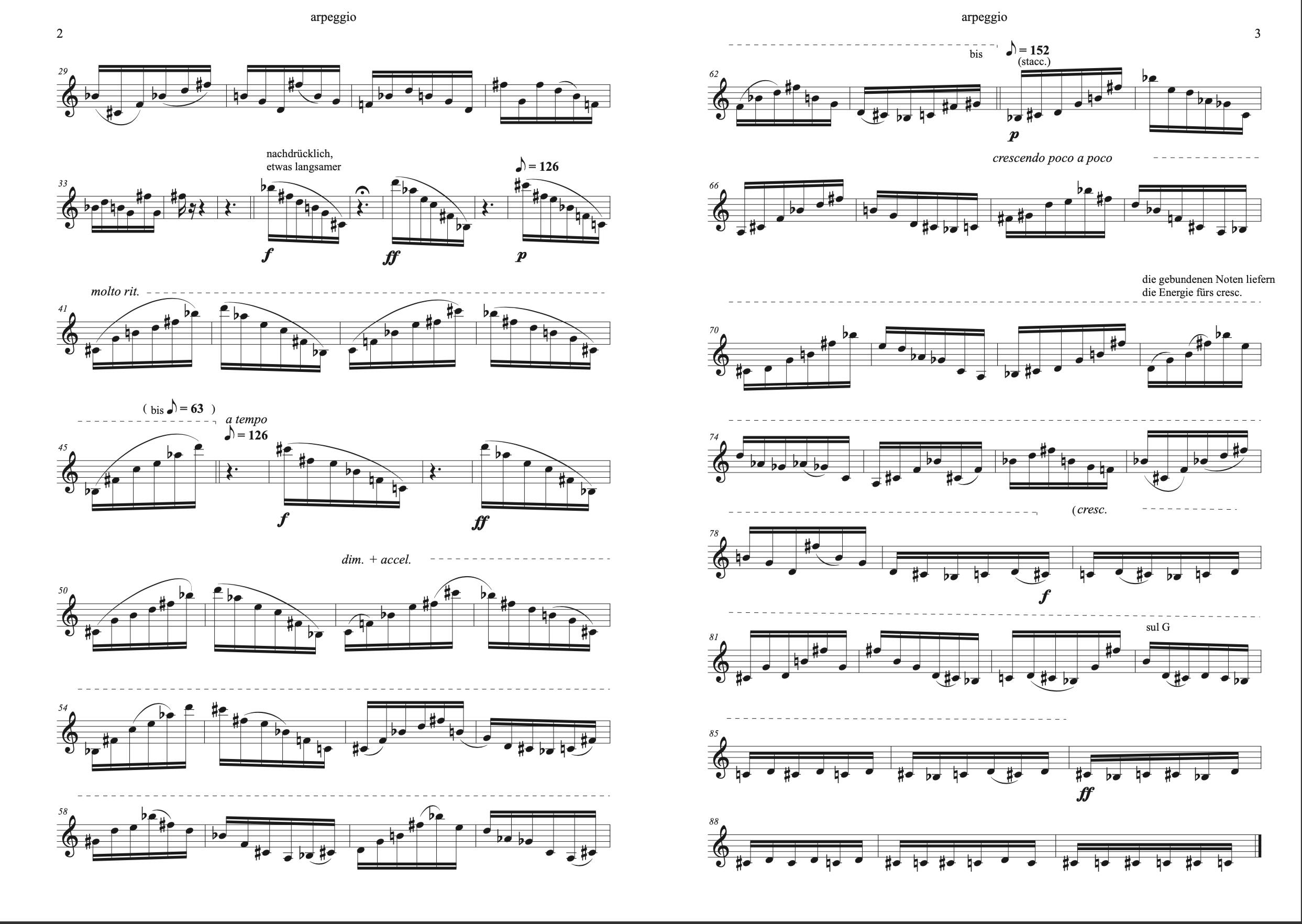
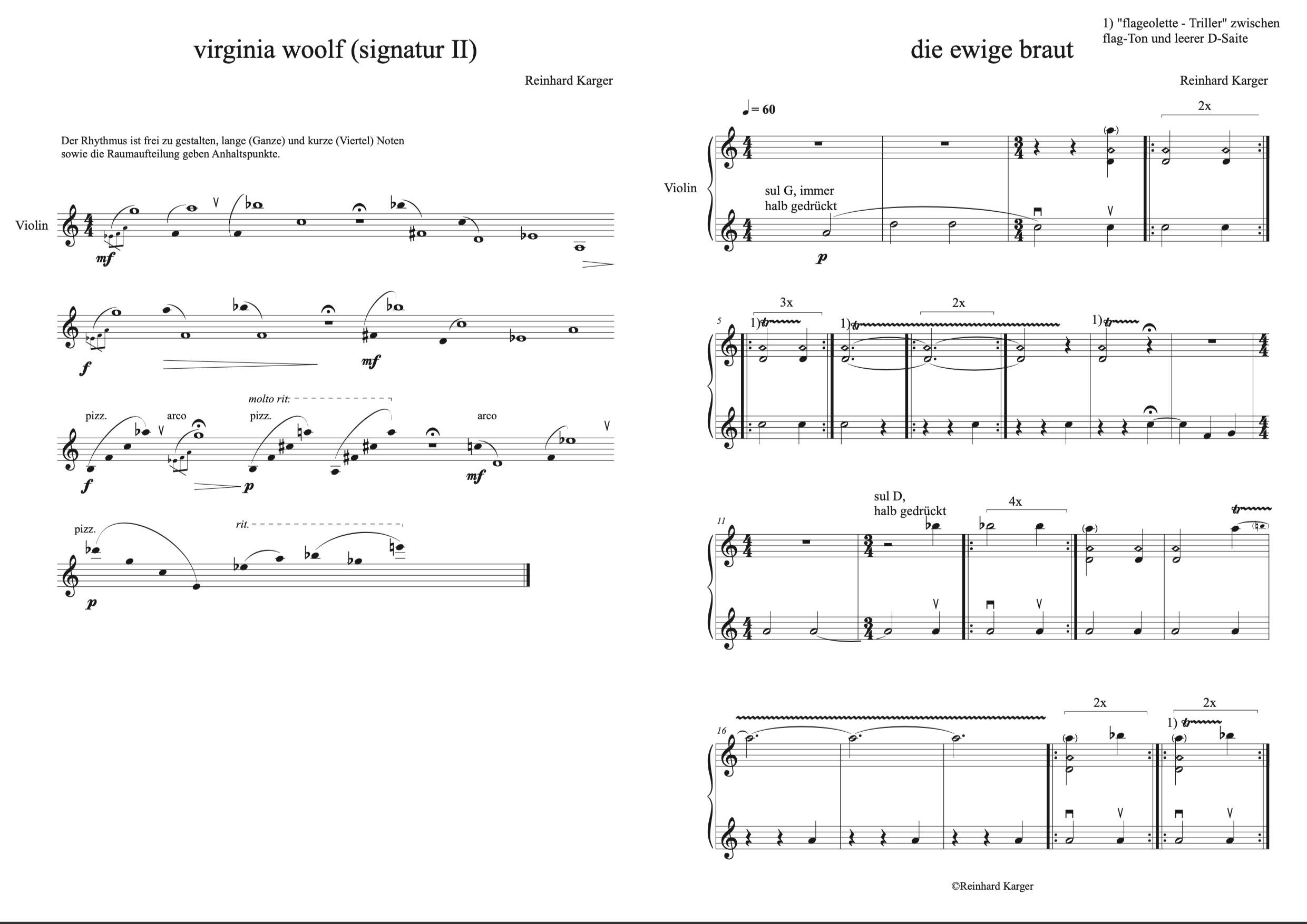
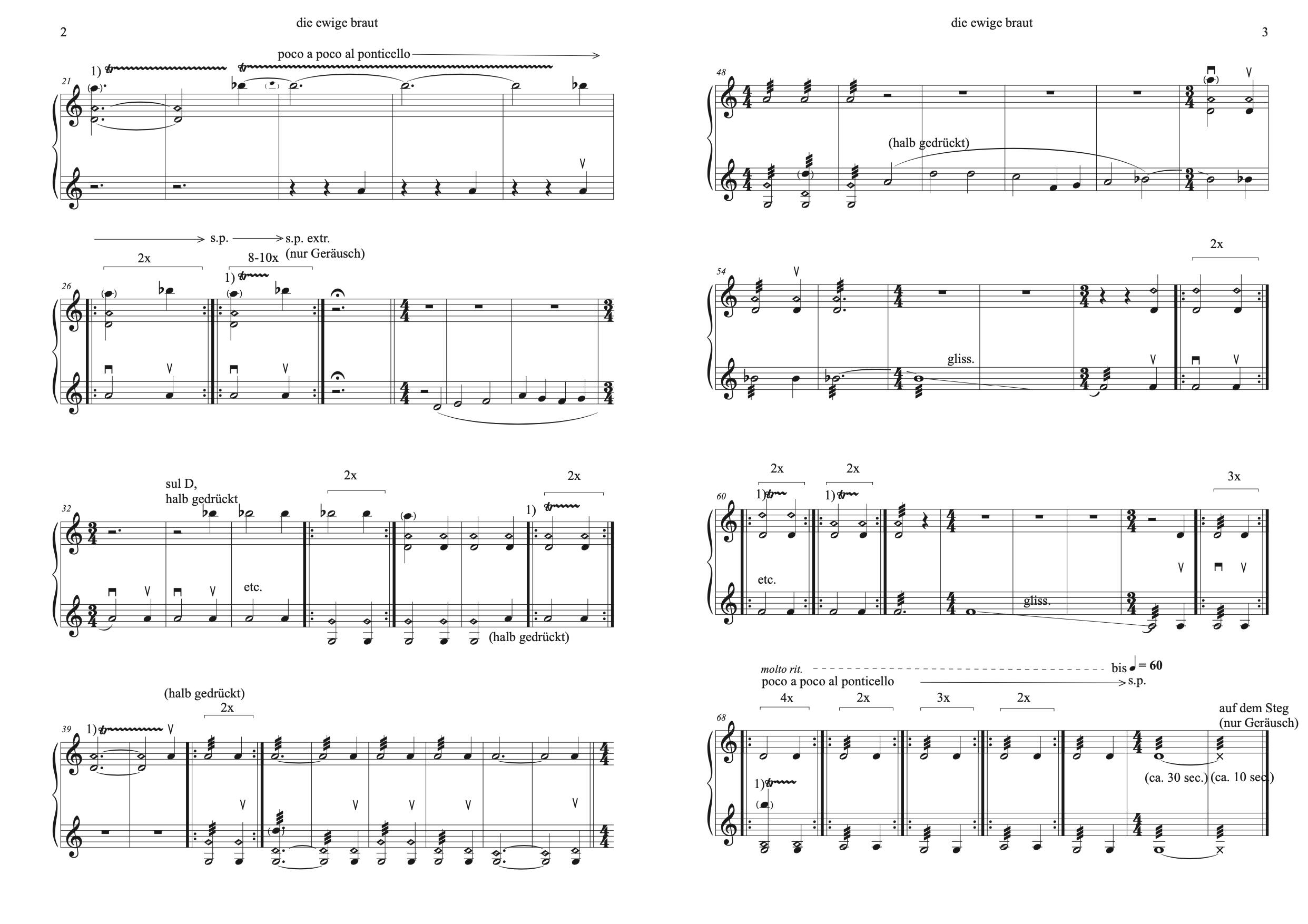
An Joseph Roth
für Klarinette solo 2011/2012Notenbeispiele
An Joseph Roth
für Klarinette solo 2011/2012Notenbeispiele
Der blinde Spiegel
Streichquartett (für Joseph Roth) 2011Den Ausgangspunkt dieser Komposition bildete die intensive literarische Begegnung mit dem großen österreichischen Schriftsteller Joseph Roth. Aus der Lektüre seiner Erzählungen entstand die Idee, eine musikalische Formulierung seines poetischen Kosmos zu versuchen, einige Aspekte dieser lapidaren und doch hochkomplexen Darstellung der untergehenden k.u.k-Monarchie und ihrer zwischen Größenwahn und Verzweiflung hin- und hergeworfenen Figuren in einer Komposition für Streichquartett zu spiegeln.Ausgangspunkt für die kompositorische Arbeit waren einige kurze Textfragmente aus der Erzählung "Der blinde Spiegel" von 1925 - das gesamte musikalische Material ist über verschiedenene strukturelle Transformationsprozesse aus diesen sprachlichen "Kraftzentren" entwickelt.Reinhard Karger
Der blinde Spiegel
Streichquartett (für Joseph Roth) 2011Den Ausgangspunkt dieser Komposition bildete die intensive literarische Begegnung mit dem großen österreichischen Schriftsteller Joseph Roth. Aus der Lektüre seiner Erzählungen entstand die Idee, eine musikalische Formulierung seines poetischen Kosmos zu versuchen, einige Aspekte dieser lapidaren und doch hochkomplexen Darstellung der untergehenden k.u.k-Monarchie und ihrer zwischen Größenwahn und Verzweiflung hin- und hergeworfenen Figuren in einer Komposition für Streichquartett zu spiegeln.Ausgangspunkt für die kompositorische Arbeit waren einige kurze Textfragmente aus der Erzählung "Der blinde Spiegel" von 1925 - das gesamte musikalische Material ist über verschiedenene strukturelle Transformationsprozesse aus diesen sprachlichen "Kraftzentren" entwickelt.Reinhard Karger
Sie saß in der Nachmittagssonne und rauchte
für Klarinette, Klavier und Vibraphon 2006 HörprobeEine junge Frau sitzt in der nachmittäglichen Sonne – in der Zeit, wo die Hitze am größten ist und der Tag still zu stehen scheint – und raucht eine Zigarette. Sie steht vor einer schwierigen Entscheidung, die ihr Leben verändern wird, und sucht einen letzten Moment der Entspannung, der Leere, bevor sie den einen Lebenspfad wählt und den anderen verwirft.
Dieses Bild aus dem Roman „Johannistag“ von Charles Lewinsky bildete den Ausgangspunkt für meine Komposition – ich habe versucht, diesen paradoxen Zustand der Entspannung in der höchsten Anspannung musikalisch zu fassen, diesen Moment des Loslassens und auf die richtige Eingebung Hoffens, bevor man gezwungen ist, zuzugreifen und sich von dem verworfenen Lebensmodell zu verabschieden.Reinhard Karger
im Juli 2006
Sie saß in der Nachmittagssonne und rauchte
für Klarinette, Klavier und Vibraphon 2006 HörprobeEine junge Frau sitzt in der nachmittäglichen Sonne – in der Zeit, wo die Hitze am größten ist und der Tag still zu stehen scheint – und raucht eine Zigarette. Sie steht vor einer schwierigen Entscheidung, die ihr Leben verändern wird, und sucht einen letzten Moment der Entspannung, der Leere, bevor sie den einen Lebenspfad wählt und den anderen verwirft.
Dieses Bild aus dem Roman „Johannistag“ von Charles Lewinsky bildete den Ausgangspunkt für meine Komposition – ich habe versucht, diesen paradoxen Zustand der Entspannung in der höchsten Anspannung musikalisch zu fassen, diesen Moment des Loslassens und auf die richtige Eingebung Hoffens, bevor man gezwungen ist, zuzugreifen und sich von dem verworfenen Lebensmodell zu verabschieden.Reinhard Karger
im Juli 2006
mes adieux – für Wolfgang Stryi
für Klarinette und Klavier 2005Wolfgang Stryi vereinte in sich zwei Eigenschaften, die bei Künstlerpersönlichkeiten nur äußerst selten gleichzeitig anzutreffen sind: Enthusiasmus und Nüchternheit – begeisterungsfähig, ansteckend, immer auf der Suche nach neuen Pfaden und mit einer nie versiegenden Energie gesegnet, und gleichzeitig stets auf die Sache bezogen, entwaffnend durch seine mit trockenem schwäbischen Humor gewürzte handwerkliche Bodenständigkeit, die jede pathetische „Künstlergeste“ vermied.
Für mich war er der ideale Partner und Bruder im Geiste, mit dem ich im Laufe von 25 Jahren – von der gemeinsamen Studienzeit an der Musikhochschule Freiburg über die musikpädagogischen Response-Prozesse bis zu den Duo-Projekten der letzten Jahre – viele Momente der stillen Freude über gemeinsam gefundene Gedanken und Klänge erleben durfte.
Kurz nachdem wir uns in Freiburg kennen gelernt hatten, schrieb ich ein langes Musiktheaterstück, in dem Wolfgang einen verliebten Klarinettisten spielen sollte. Das Stück war sehr kompliziert und wir haben eineinhalb Jahre geprobt, bis es endlich uraufgeführt wurde – eine Arbeit, die viel Kraft gekostet hatte und ökonomisch völlig unsinnig war. Wir waren jedoch sehr stolz auf unsere Zähigkeit und unser Durchhaltevermögen, und Wolfgang hat später berichtet, dass das Erlebnis dieses Prozesses ihn dazu gebracht hat, sein Leben der zeitgenössischen Musik zu widmen.
Einmal waren wir mit unserem letzten Programm „SMS – short music stories“ bei einer Serie von open-air-Matineen in Frankfurt eingeladen, es war 11 Uhr morgens, es regnete in Strömen und es war genau ein Zuschauer gekommen. Den betretenen Mienen bei Veranstaltern und Technikern begegnete Wolfgang mit dem für ihn typischen Satz: „Los geht’s, wenn einer zuhört, wird gespielt!“
Im Februar 2005 – mitten im Leben, im Zenit seiner künstlerischen Laufbahn als Saxophonist und Bassklarinettist beim Frankfurter Ensemble Modern – ist Wolfgang Stryi gestorben. „mes adieux“ ist seinem Andenken gewidmet.Reinhard Karger
im Dezember 2005
mes adieux – für Wolfgang Stryi
für Klarinette und Klavier 2005Wolfgang Stryi vereinte in sich zwei Eigenschaften, die bei Künstlerpersönlichkeiten nur äußerst selten gleichzeitig anzutreffen sind: Enthusiasmus und Nüchternheit – begeisterungsfähig, ansteckend, immer auf der Suche nach neuen Pfaden und mit einer nie versiegenden Energie gesegnet, und gleichzeitig stets auf die Sache bezogen, entwaffnend durch seine mit trockenem schwäbischen Humor gewürzte handwerkliche Bodenständigkeit, die jede pathetische „Künstlergeste“ vermied.
Für mich war er der ideale Partner und Bruder im Geiste, mit dem ich im Laufe von 25 Jahren – von der gemeinsamen Studienzeit an der Musikhochschule Freiburg über die musikpädagogischen Response-Prozesse bis zu den Duo-Projekten der letzten Jahre – viele Momente der stillen Freude über gemeinsam gefundene Gedanken und Klänge erleben durfte.
Kurz nachdem wir uns in Freiburg kennen gelernt hatten, schrieb ich ein langes Musiktheaterstück, in dem Wolfgang einen verliebten Klarinettisten spielen sollte. Das Stück war sehr kompliziert und wir haben eineinhalb Jahre geprobt, bis es endlich uraufgeführt wurde – eine Arbeit, die viel Kraft gekostet hatte und ökonomisch völlig unsinnig war. Wir waren jedoch sehr stolz auf unsere Zähigkeit und unser Durchhaltevermögen, und Wolfgang hat später berichtet, dass das Erlebnis dieses Prozesses ihn dazu gebracht hat, sein Leben der zeitgenössischen Musik zu widmen.
Einmal waren wir mit unserem letzten Programm „SMS – short music stories“ bei einer Serie von open-air-Matineen in Frankfurt eingeladen, es war 11 Uhr morgens, es regnete in Strömen und es war genau ein Zuschauer gekommen. Den betretenen Mienen bei Veranstaltern und Technikern begegnete Wolfgang mit dem für ihn typischen Satz: „Los geht’s, wenn einer zuhört, wird gespielt!“
Im Februar 2005 – mitten im Leben, im Zenit seiner künstlerischen Laufbahn als Saxophonist und Bassklarinettist beim Frankfurter Ensemble Modern – ist Wolfgang Stryi gestorben. „mes adieux“ ist seinem Andenken gewidmet.Reinhard Karger
im Dezember 2005
Die späte Welt
sieben geistliche Stücke für gemischten Chor,
Solosopran, Mandoline und Kontrabass 2004 - 2006 HörprobeVerwendete Texte:Die Hertzen„mein Herz ängstigt sich in meinem Leibe, und des Todes Furcht ist auf mich gefallen.“ (Ps. 55,5)Die Opffer„wir sind Brunnen ohne Wasser, und Wolken, vom Windwirbel umgetrieben, welchen behalten ist eine dunkle Finsternis in Ewigkeit.“ (2. Petr. 2,17)„wenn eure Sünde gleich blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden; und wenn sie gleich ist wie Scharlach, so soll sie doch wie Wolle werden.“ (Jes 1,18)Schönster Ort„Christe, du bist der helle Tag, vor dir die Nacht nicht bleiben mag. Du leuchtest uns vom Vater her und bist des Lichtes Prediger.“ (Erasmus Alber ca. 1536)Die späte Welt„vom Odem Gottes kommt Frost, und große Wasser ziehen sich eng zusammen; von Mittag her kommt Wetter und von Mitternacht Kälte.Und sein Blitz scheint auf die Enden der Erde; ihm nach brüllt der Donner, und er donnert mit seinem großen Schall. Die Wolken beschwert er mit Wasser, und durch das Gewölk bricht sein Licht. Von Mitternacht kommt Gold, um Gott her ist schrecklicher Glanz.“ (aus Hiob 37)
Die späte Welt
sieben geistliche Stücke für gemischten Chor,
Solosopran, Mandoline und Kontrabass 2004 - 2006 HörprobeVerwendete Texte:Die Hertzen„mein Herz ängstigt sich in meinem Leibe, und des Todes Furcht ist auf mich gefallen.“ (Ps. 55,5)Die Opffer„wir sind Brunnen ohne Wasser, und Wolken, vom Windwirbel umgetrieben, welchen behalten ist eine dunkle Finsternis in Ewigkeit.“ (2. Petr. 2,17)„wenn eure Sünde gleich blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden; und wenn sie gleich ist wie Scharlach, so soll sie doch wie Wolle werden.“ (Jes 1,18)Schönster Ort„Christe, du bist der helle Tag, vor dir die Nacht nicht bleiben mag. Du leuchtest uns vom Vater her und bist des Lichtes Prediger.“ (Erasmus Alber ca. 1536)Die späte Welt„vom Odem Gottes kommt Frost, und große Wasser ziehen sich eng zusammen; von Mittag her kommt Wetter und von Mitternacht Kälte.Und sein Blitz scheint auf die Enden der Erde; ihm nach brüllt der Donner, und er donnert mit seinem großen Schall. Die Wolken beschwert er mit Wasser, und durch das Gewölk bricht sein Licht. Von Mitternacht kommt Gold, um Gott her ist schrecklicher Glanz.“ (aus Hiob 37)
Ein Fallen im Wind
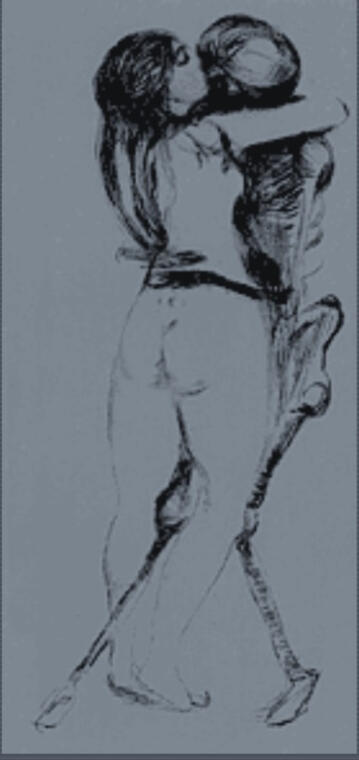
Fragment für Stimme und Streichquartett
2002(nach einem Text von Marieluise Fleißer)Die prekäre Gleichzeitigkeit von Lust und Grauen, die in Edvard Munchs genialer Zeichnung durch das ungleiche Liebespaar – im wahrsten Sinne des Wortes – "verkörpert" wird, tritt in Fleißers Textabschnitt über die letzten Momente im Leben eines Mädchens – vor dem Selbstmord – als Hin- und Hergerissensein zwischen Todesangst und Todessehnsucht in Erscheinung.
Da dieser Text meiner Komposition für Stimme und Streichquartett zugrundeliegt, sei er hier zitiert:
"Einstweilen war es draußen schon stille Nacht geworden. Dies erblichene Gesicht ohne Zusammenhang der Züge schaute nicht mehr nach dem Regen aus. Dr Wind drang um das Fensterkreuz, stieß ins Zimmer vor, da mußte sich gut hineingegeben sein wie in eine kraft. Der Wind legte sich in ihre Züge ein wie in Wasser, das er trieb. Da war kein Einzelwille mehr, der in ihr widerstand. Wie alles, was wächst in der Natur, wuchs sie nur noch in dies Fallen hinein, ein Fallen im Wind, sie ging dem Fenster zu wie gezogen."
( aus: "Ein Pfund Orangen" von Marie-Luise Fleißer )PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 15. Juli 2002Eine neue, leise SchönheitZur Documenta 11: Schubert und Karger in der Kasseler MartinskircheVon Georg PeplEs war ein theatralischer Augenblick beim siebten Termin der Reihe zur Documenta 11 x 21 Uhr in der Martinskirche. Kaum hatte das Spohr-Quartett Kassel (Dimitrios Papanikolau, Rüdiger Spuck, Ute Varevics und Wolfram Geiss) den ersten Satz von Franz Schuberts d-moll-Quartett beendet, da schloss, von der Altistin Mechthild Seitz suggestiv vorgetragen, die Liedfassung von Der Tod und das Mädchen an. Ohne Unterbrechung durch Beifall, sodass die zahlreichen Zuhörer sich ganz in die dunkle Stimmung vertiefen konnten.Der Kasseler Komponist Reinhard Karger hat dieses Konzertprojekt konzipiert, Schuberts Liedbegleitung für Streicher bearbeitet und selbst zwei Werke beigesteuert. Bei seinen rund 35 Minuten dauernden Hölderlin-Fragmenten Tod. Richtkraft für Frauenstimme, Streichtrio und Tonband (1988) schwebte ihm eine neue, leise Art von Schönheit vor. Und dies war vollkommen nachzuvollziehen, da es Klänge von großer sinnlicher Evidenz zu hören gab.Zwar herrscht in Kargers Musiksprache das Verhaltene und Reduzierte vor, doch es kommt auch zu expressiven Ausbrüchen - vielleicht ein Schubert verwandter Zug. So baut sich hier über tonalen Motivfetzen und einem punktierten Rhythmus, die beide wie Zitate erscheinen, Spannung auf. Vom Tonband erklingen aggressive Demonstrations-Geräusche, eine Kinderstimme verkündet: Dies ist die Zeit der Könige nicht mehr. Danach stellt ein längerer Ausschnitt klar, was hier verarbeitet wurde - Bruchstücke aus Beethovens Großer Fuge.Dies schafft eine Verbindung zwischen den enttäuschten Revolutionären Beethoven und Hölderlin, und darüber hinaus wird aus dem so anfangs so stillen Werk politische Musik. Sie bezieht ihre Aussage durch eine vom Existenzialismus inspirierte Hölderlin-Lesart: Das Annehmen der Vergänglichkeit ermögliche erst produktive und richtungsgebende Entscheidungen.Eine weitere Facette des Themas, nämlich Todesangst und Todessehnsucht, eröffnet Marieluise Fleißner in der Erzählung Drei Pfund Orangen, der literarischen Vorlage für Kargers Ein Fallen im Wind. In diesem kurzen Stück für Altstimme und Streichquartett verdeutlichen fallende Glissandi den Titel , ohne plakativ zu wirken. Unmittelbar ansprechend sind auch hier die gläsern-zerbrechlichen Klänge und die originelle Harmonik, die selbst einem scheinbar abgedroschenen verminderten Nonenakkord neue Ausdruckswerte zuführt. Eine eindrucksvolle Uraufführung in einem atmosphärisch dichten Nachtkonzert.
Ein Fallen im Wind
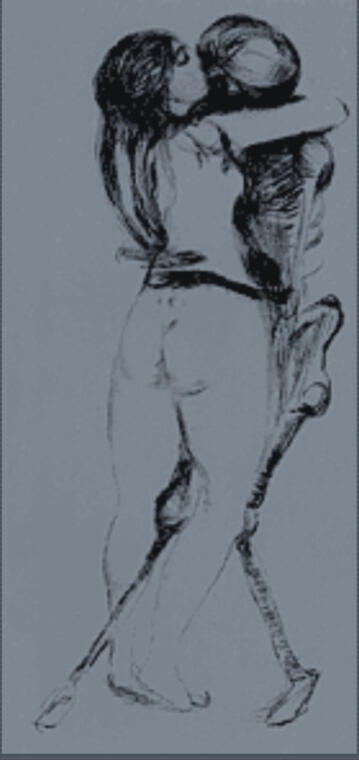
Fragment für Stimme und Streichquartett
2002(nach einem Text von Marieluise Fleißer)Die prekäre Gleichzeitigkeit von Lust und Grauen, die in Edvard Munchs genialer Zeichnung durch das ungleiche Liebespaar – im wahrsten Sinne des Wortes – "verkörpert" wird, tritt in Fleißers Textabschnitt über die letzten Momente im Leben eines Mädchens – vor dem Selbstmord – als Hin- und Hergerissensein zwischen Todesangst und Todessehnsucht in Erscheinung.
Da dieser Text meiner Komposition für Stimme und Streichquartett zugrundeliegt, sei er hier zitiert:
"Einstweilen war es draußen schon stille Nacht geworden. Dies erblichene Gesicht ohne Zusammenhang der Züge schaute nicht mehr nach dem Regen aus. Dr Wind drang um das Fensterkreuz, stieß ins Zimmer vor, da mußte sich gut hineingegeben sein wie in eine kraft. Der Wind legte sich in ihre Züge ein wie in Wasser, das er trieb. Da war kein Einzelwille mehr, der in ihr widerstand. Wie alles, was wächst in der Natur, wuchs sie nur noch in dies Fallen hinein, ein Fallen im Wind, sie ging dem Fenster zu wie gezogen."
( aus: "Ein Pfund Orangen" von Marie-Luise Fleißer )PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 15. Juli 2002Eine neue, leise SchönheitZur Documenta 11: Schubert und Karger in der Kasseler MartinskircheVon Georg PeplEs war ein theatralischer Augenblick beim siebten Termin der Reihe zur Documenta 11 x 21 Uhr in der Martinskirche. Kaum hatte das Spohr-Quartett Kassel (Dimitrios Papanikolau, Rüdiger Spuck, Ute Varevics und Wolfram Geiss) den ersten Satz von Franz Schuberts d-moll-Quartett beendet, da schloss, von der Altistin Mechthild Seitz suggestiv vorgetragen, die Liedfassung von Der Tod und das Mädchen an. Ohne Unterbrechung durch Beifall, sodass die zahlreichen Zuhörer sich ganz in die dunkle Stimmung vertiefen konnten.Der Kasseler Komponist Reinhard Karger hat dieses Konzertprojekt konzipiert, Schuberts Liedbegleitung für Streicher bearbeitet und selbst zwei Werke beigesteuert. Bei seinen rund 35 Minuten dauernden Hölderlin-Fragmenten Tod. Richtkraft für Frauenstimme, Streichtrio und Tonband (1988) schwebte ihm eine neue, leise Art von Schönheit vor. Und dies war vollkommen nachzuvollziehen, da es Klänge von großer sinnlicher Evidenz zu hören gab.Zwar herrscht in Kargers Musiksprache das Verhaltene und Reduzierte vor, doch es kommt auch zu expressiven Ausbrüchen - vielleicht ein Schubert verwandter Zug. So baut sich hier über tonalen Motivfetzen und einem punktierten Rhythmus, die beide wie Zitate erscheinen, Spannung auf. Vom Tonband erklingen aggressive Demonstrations-Geräusche, eine Kinderstimme verkündet: Dies ist die Zeit der Könige nicht mehr. Danach stellt ein längerer Ausschnitt klar, was hier verarbeitet wurde - Bruchstücke aus Beethovens Großer Fuge.Dies schafft eine Verbindung zwischen den enttäuschten Revolutionären Beethoven und Hölderlin, und darüber hinaus wird aus dem so anfangs so stillen Werk politische Musik. Sie bezieht ihre Aussage durch eine vom Existenzialismus inspirierte Hölderlin-Lesart: Das Annehmen der Vergänglichkeit ermögliche erst produktive und richtungsgebende Entscheidungen.Eine weitere Facette des Themas, nämlich Todesangst und Todessehnsucht, eröffnet Marieluise Fleißner in der Erzählung Drei Pfund Orangen, der literarischen Vorlage für Kargers Ein Fallen im Wind. In diesem kurzen Stück für Altstimme und Streichquartett verdeutlichen fallende Glissandi den Titel , ohne plakativ zu wirken. Unmittelbar ansprechend sind auch hier die gläsern-zerbrechlichen Klänge und die originelle Harmonik, die selbst einem scheinbar abgedroschenen verminderten Nonenakkord neue Ausdruckswerte zuführt. Eine eindrucksvolle Uraufführung in einem atmosphärisch dichten Nachtkonzert.
the penrose piano book of pentatonic secrets
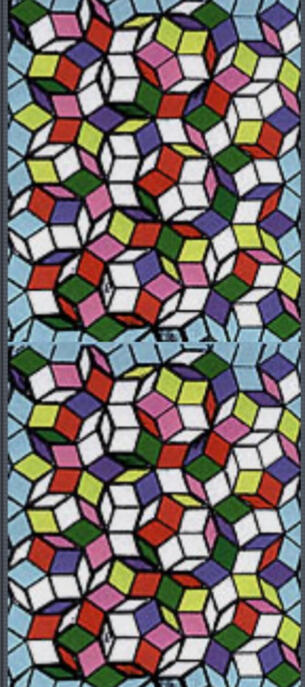
Hellmuth Vivell gewidmet
für Klavier solo 2000/01 HörprobeKomplette Playlist auf soundcloud.comDer englische Mathematiker Roger Penrose hat ein faszinierendes Puzzle erdacht: es besteht aus nur zwei Grundelementen - einer großen und einer kleinen Raute - und ergibt als Ganzes doch ein äußerst komplexes und irritierendes Bild. Man erkennt sofort, daß es geordnete, kristallähnliche Strukturen aufweist, kann aber weder ein Zentrum noch - wie sonst bei Kristallen - einen überall identischen kleinsten Grundbaustein ausmachen. Dieses Puzzle versetzt Auge und Gehirn in einen genauso paradoxen wie beunruhigenden Zustand: Chaos und Ordnung gleichzeitig. Die Unruhe rührt daher, daß es sich hier um eine sogenannte "fünfzählige" Struktur handelt: die Seitenlinien aller Rauten ordnen sich parallel zu fünf das Winkeltotal von 360° gleichmäßig unterteilenden Achsen (also eine Art fünfzähliges Koordinatensystem), und das ist für unsere Wahrnehmung und für unser Denken äußerst ungewöhnlich.Ich habe - ausgehend von diesem ersten Eindruck - versucht, eine parallele musikalische Welt zu erschaffen, die auch von ganz einfachen Grundelementen ausgeht (fünftönige Akkorde) und durch vielfältige Transformationen zu sehr verschiedenartigen Gewichtungen von Ordnung und Chaos gelangt. Auf diese Weise entstand eine neue Art "Pentatonik" - eine experimentelle "Fünftonmusik".Kassel, 2. Juli 2001 Reinhard Karger
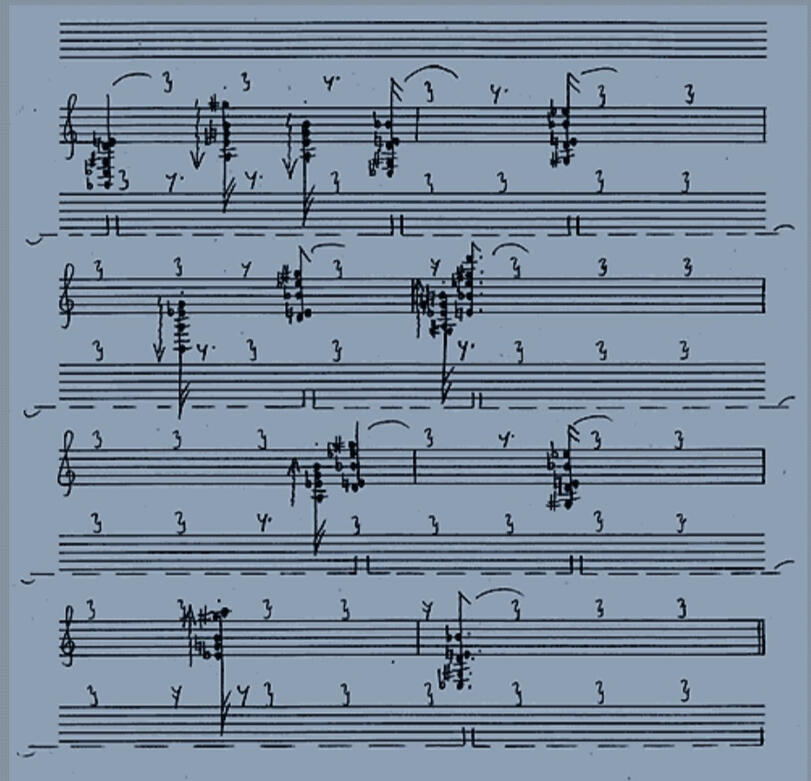
PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 24. September 2001NEUE KLAVIERMUSIKEin Komponist der Nicht-BeliebigkeitEinen Musiker der Nicht-Beliebigkeit, so darf man den Kasseler Komponisten Reinhard Karger nennen. Er hält sich an die Einsicht, dass reduziertes Material und die Arbeit mit Systemen die Phantasie anspornt, nicht einschränkt. Aktuelles Beispiel dafür ist the penrose piano book of pentatonic secrets, das Hellmuth Vivell bei einem Konzert mit neuer Klaviermusik im Gießhaus der GhK zur Kasseler Erstaufführung brachte.Eine geglückte Verbindung von Strenge und Unmittelbarkeit: Der eine gute halbe Stunde dauernde Zyklus - angeregt durch ein mit den Kategorien Chaos und Ordnung spielendes Puzzle des Mathematikers Roger Penrose - hat fünf, nicht aus herkömmlicher Pentatonik gebildete fünftönige Akkorde zur Basis. Daraus lässt Karger eine Klangwelt entstehen, die entfernt an diejenige Morton Feldmans erinnert und die zu besonders intensivem Zuhören einlädt - gerade weil wenige Ereignisse stattfinden, Langsamkeit und zurückgenommene Dynamik vorherrschen.Aber die Zartheit ist Gefährdungen ausgesetzt. So mutet im abschließenden 15. Stück ein Crescendo bis zum vierfachen Fortissimo wie ein katastrophischer Vorgang an. Und es ist Zeichen eines feinen Gespürs, dass darauf ein verhaltener Epilog folgt: Emotionalität, die mit Urelementen wie Spannung und Entspannung arbeitet - ohne abgestanden zu wirken. ( ... )Helmuth Vivell - nicht nur in Kassel ein gefragter Pianist, wie Auftritte etwa bei Gidon Kremers rennommiertem Lockenhaus-Festival belegen - war ein ausgezeichneter Anwalt dieser Werke. Es ist auch seiner Sensibilität und Ruhe zu danken, dass Kargers Pentatonische Geheimnisse so starken Eindruck hinterließen.
Georg Pepl
the penrose piano book of pentatonic secrets
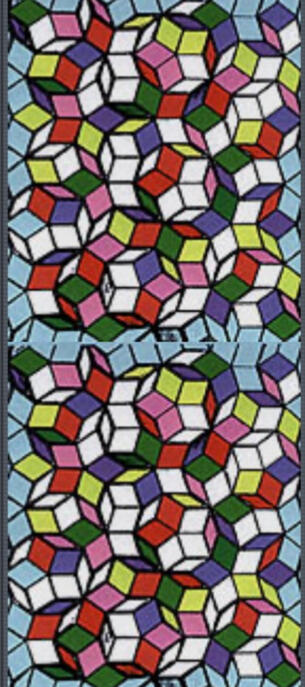
Hellmuth Vivell gewidmet
für Klavier solo 2000/01 HörprobeKomplette Playlist auf soundcloud.comDer englische Mathematiker Roger Penrose hat ein faszinierendes Puzzle erdacht: es besteht aus nur zwei Grundelementen - einer großen und einer kleinen Raute - und ergibt als Ganzes doch ein äußerst komplexes und irritierendes Bild. Man erkennt sofort, daß es geordnete, kristallähnliche Strukturen aufweist, kann aber weder ein Zentrum noch - wie sonst bei Kristallen - einen überall identischen kleinsten Grundbaustein ausmachen. Dieses Puzzle versetzt Auge und Gehirn in einen genauso paradoxen wie beunruhigenden Zustand: Chaos und Ordnung gleichzeitig. Die Unruhe rührt daher, daß es sich hier um eine sogenannte "fünfzählige" Struktur handelt: die Seitenlinien aller Rauten ordnen sich parallel zu fünf das Winkeltotal von 360° gleichmäßig unterteilenden Achsen (also eine Art fünfzähliges Koordinatensystem), und das ist für unsere Wahrnehmung und für unser Denken äußerst ungewöhnlich.Ich habe - ausgehend von diesem ersten Eindruck - versucht, eine parallele musikalische Welt zu erschaffen, die auch von ganz einfachen Grundelementen ausgeht (fünftönige Akkorde) und durch vielfältige Transformationen zu sehr verschiedenartigen Gewichtungen von Ordnung und Chaos gelangt. Auf diese Weise entstand eine neue Art "Pentatonik" - eine experimentelle "Fünftonmusik".Kassel, 2. Juli 2001 Reinhard Karger
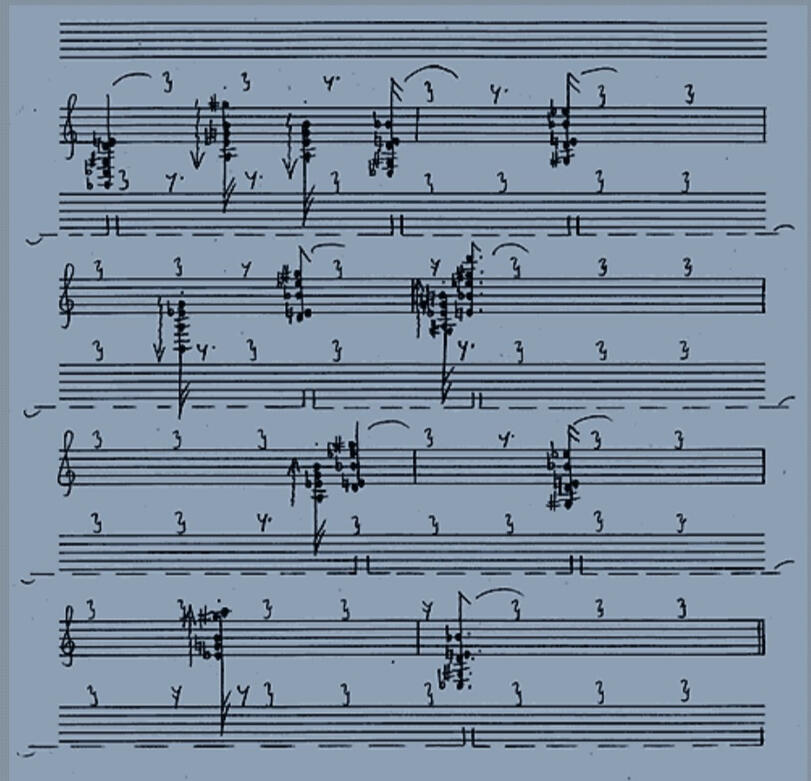
PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 24. September 2001NEUE KLAVIERMUSIKEin Komponist der Nicht-BeliebigkeitEinen Musiker der Nicht-Beliebigkeit, so darf man den Kasseler Komponisten Reinhard Karger nennen. Er hält sich an die Einsicht, dass reduziertes Material und die Arbeit mit Systemen die Phantasie anspornt, nicht einschränkt. Aktuelles Beispiel dafür ist the penrose piano book of pentatonic secrets, das Hellmuth Vivell bei einem Konzert mit neuer Klaviermusik im Gießhaus der GhK zur Kasseler Erstaufführung brachte.Eine geglückte Verbindung von Strenge und Unmittelbarkeit: Der eine gute halbe Stunde dauernde Zyklus - angeregt durch ein mit den Kategorien Chaos und Ordnung spielendes Puzzle des Mathematikers Roger Penrose - hat fünf, nicht aus herkömmlicher Pentatonik gebildete fünftönige Akkorde zur Basis. Daraus lässt Karger eine Klangwelt entstehen, die entfernt an diejenige Morton Feldmans erinnert und die zu besonders intensivem Zuhören einlädt - gerade weil wenige Ereignisse stattfinden, Langsamkeit und zurückgenommene Dynamik vorherrschen.Aber die Zartheit ist Gefährdungen ausgesetzt. So mutet im abschließenden 15. Stück ein Crescendo bis zum vierfachen Fortissimo wie ein katastrophischer Vorgang an. Und es ist Zeichen eines feinen Gespürs, dass darauf ein verhaltener Epilog folgt: Emotionalität, die mit Urelementen wie Spannung und Entspannung arbeitet - ohne abgestanden zu wirken. ( ... )Helmuth Vivell - nicht nur in Kassel ein gefragter Pianist, wie Auftritte etwa bei Gidon Kremers rennommiertem Lockenhaus-Festival belegen - war ein ausgezeichneter Anwalt dieser Werke. Es ist auch seiner Sensibilität und Ruhe zu danken, dass Kargers Pentatonische Geheimnisse so starken Eindruck hinterließen.
Georg Pepl
Komm, o Tod, du Schlafes Bruder
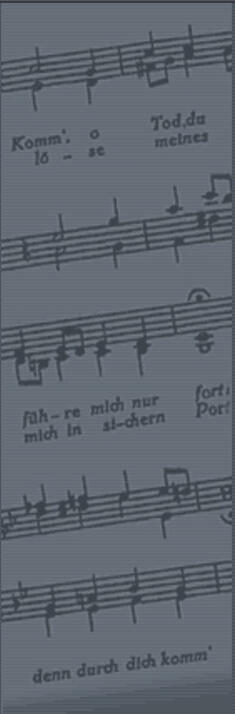
für achtstimmigen gemischten Chor a capella
1998/99
Hörprobe - Real Audio"Komm, o Tod, du Schlafes Bruder"Komm, o Tod, du Schlafes Bruder,
Komm und führe mich nur fort.
Löse meines Schiffleins Ruder,
Bringe mich in sichern Port.
Diese Halbstrophe aus dem Lied "0 du schönes Weltgebäude" von Johann Franck (1618-1677) sowie die zugehörige Choralvertonung von Johann Sebastian Bach bilden den inhaltlichen und strukturellen Ausgangspunkt für meine Komposition.Wie ein Pilzsucher bewege ich mich langsam und geduldig in den Klanglandschaften des 4stimmigen Bach-Satzes und des Textes und entdecke von Zeit zu Zeit kleine Strukturen, die dem nur auf das Ganze gerichteten Blick verborgen bleiben, ich "pflücke" sie und lasse mich von ihnen zu einer neuen musikalischen Formulierung des Themas ,,Tod" führen.Folgende Bilder und Strukturen tragen dann zur endgültigen Formung bei:- der unauflösliche Gegensatz von Erlösungssehnsucht und Todesschrecken;- der Verbrennungsvorgang: eine klar definierte Einheit unserer Lebenswirklichkeit (ein Stück Holz, eine Kerze, ein Mensch) wird zerlegt, die beiden Endprodukte gehören ganz verschiedenen Welten an - ein körperlicher Rest, der Erde zugehörig und eine körperlose Substanz, je nach Standpunkt des Betrachters Rauch, Wesen oder Seele genannt, dem Reich der Luft und des Himmels assoziiert;- die ,,Beinhausmusik": die diebische Freude der aus den Gräbern hervorgestiegenen Skelette auf mittelalterlichen Totentanzdarstellungen an der Hervorbringung unbotmäßiger Töne und Geräusche;
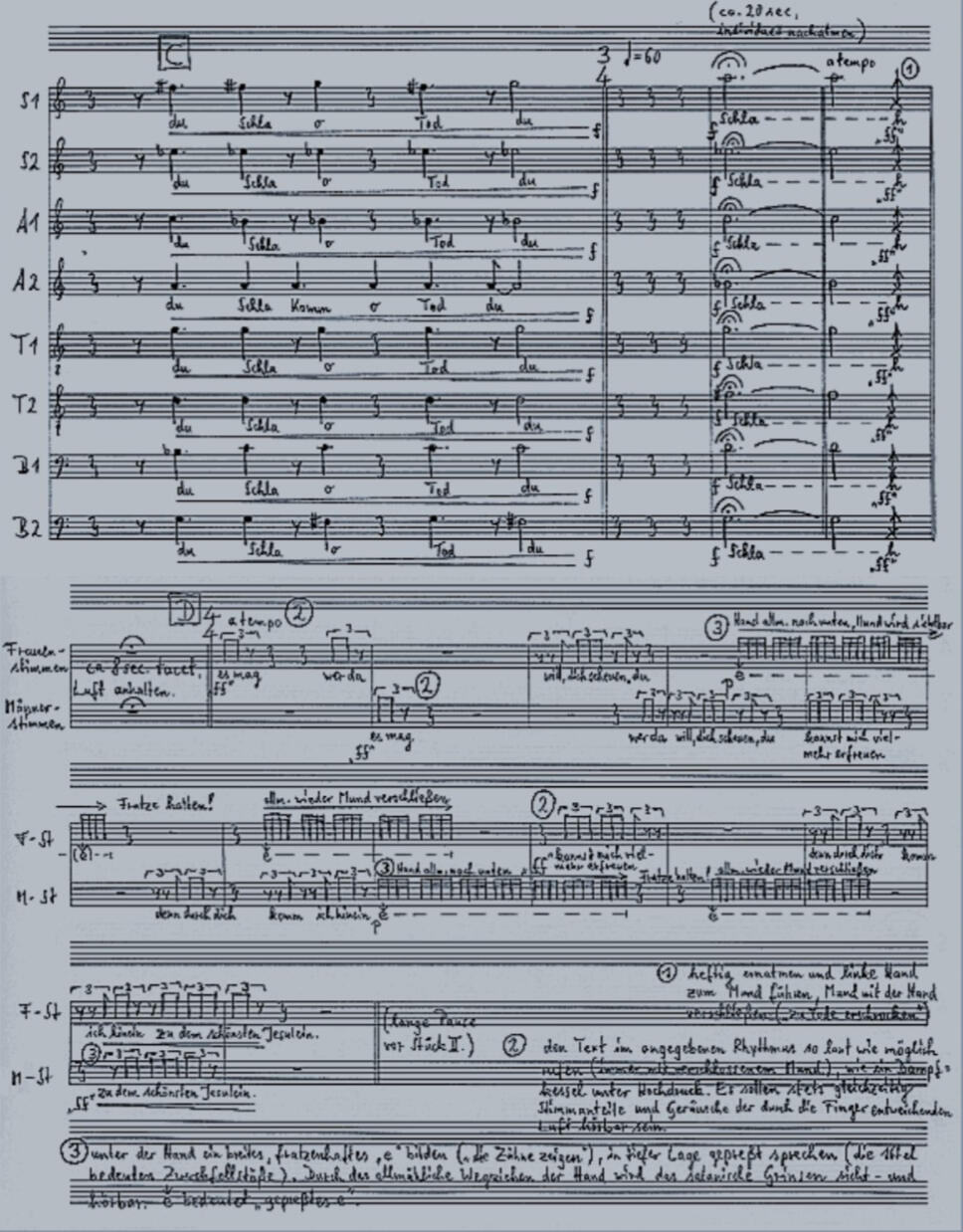
- der Tod als mathematisches Problem: Ein Gebiet der neueren Mathematik ist die fraktale Geometrie, wo unter anderem untersucht wird, wie sich Strukturen verhalten, wenn sie sehr oft nach immer der gleichen Regel abgebildet werden.
Das Faszinierende ist, daß man, auch wenn eine eindeutige Ausgangsstruktur und eine klar festgelegte Abbildungsregel vorliegt, nicht voraussagen kann, wie sich die Struktur verhalten wird. Manche Strukturen wuchern und vergrößern sich anscheinend unkontrollierbar, andere sterben einfach aus.
Ein wesentlicher Grundsatz der traditionellen Mathematik, die kausale Vorhersagbarkeit, wird also außer Kraft gesetzt, die einzige Möglichkeit, Gewißheit zu bekommen, ist, es auszuprobieren.
So schleichen sich durch die Hintertür der Zufall und die Ungewißheit sogar wieder in ein scheinbar so klares, gläsernes Gebäude wie das der Mathematik.
Neben diesem grundsätzlich interessanten Aspekt ist für meine Komposition vor allem das Phänomen der erwähnten ,,aussterbenden Strukturen" von Bedeutung.
Reinhard Karger
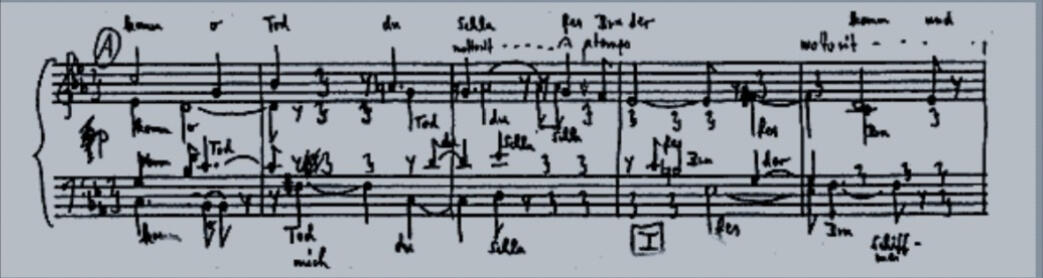
PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, Juni 1999NEUE MUSIK IN DER KIRCHEDer Blick zurück dominiert(...) Reinhard Kargers Stück für achtstimmigen Chor "Komm, o Tod, du Schlafes Bruder", die andere große Uraufführung des Abends, wirkt aufs Ganze gesehen eher statisch. Allerdings fächert der Kasseler Komponist die Todesthematik eindrucksvoll in zwei gegensätzliche Klang- und Ausdrucksebenen auf, eine grotesk-geräuschhafte "Beinhaus"-Musik und eine durch komplexe Akkordik bezeichnete "Entgrenzungsmusik" Beide Sphären durchdringen sich, ohne sich aufzulösen. Auch hier war Hans Darmstadt mit dem sehr engagierten Vokalensemble der Uraufführungsdirigent (...)
Werner Fritsch
Komm, o Tod, du Schlafes Bruder
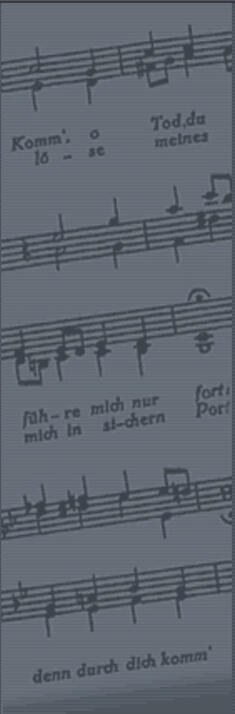
für achtstimmigen gemischten Chor a capella
1998/99
Hörprobe - Real Audio"Komm, o Tod, du Schlafes Bruder"Komm, o Tod, du Schlafes Bruder,
Komm und führe mich nur fort.
Löse meines Schiffleins Ruder,
Bringe mich in sichern Port.
Diese Halbstrophe aus dem Lied "0 du schönes Weltgebäude" von Johann Franck (1618-1677) sowie die zugehörige Choralvertonung von Johann Sebastian Bach bilden den inhaltlichen und strukturellen Ausgangspunkt für meine Komposition.Wie ein Pilzsucher bewege ich mich langsam und geduldig in den Klanglandschaften des 4stimmigen Bach-Satzes und des Textes und entdecke von Zeit zu Zeit kleine Strukturen, die dem nur auf das Ganze gerichteten Blick verborgen bleiben, ich "pflücke" sie und lasse mich von ihnen zu einer neuen musikalischen Formulierung des Themas ,,Tod" führen.Folgende Bilder und Strukturen tragen dann zur endgültigen Formung bei:- der unauflösliche Gegensatz von Erlösungssehnsucht und Todesschrecken;- der Verbrennungsvorgang: eine klar definierte Einheit unserer Lebenswirklichkeit (ein Stück Holz, eine Kerze, ein Mensch) wird zerlegt, die beiden Endprodukte gehören ganz verschiedenen Welten an - ein körperlicher Rest, der Erde zugehörig und eine körperlose Substanz, je nach Standpunkt des Betrachters Rauch, Wesen oder Seele genannt, dem Reich der Luft und des Himmels assoziiert;- die ,,Beinhausmusik": die diebische Freude der aus den Gräbern hervorgestiegenen Skelette auf mittelalterlichen Totentanzdarstellungen an der Hervorbringung unbotmäßiger Töne und Geräusche;
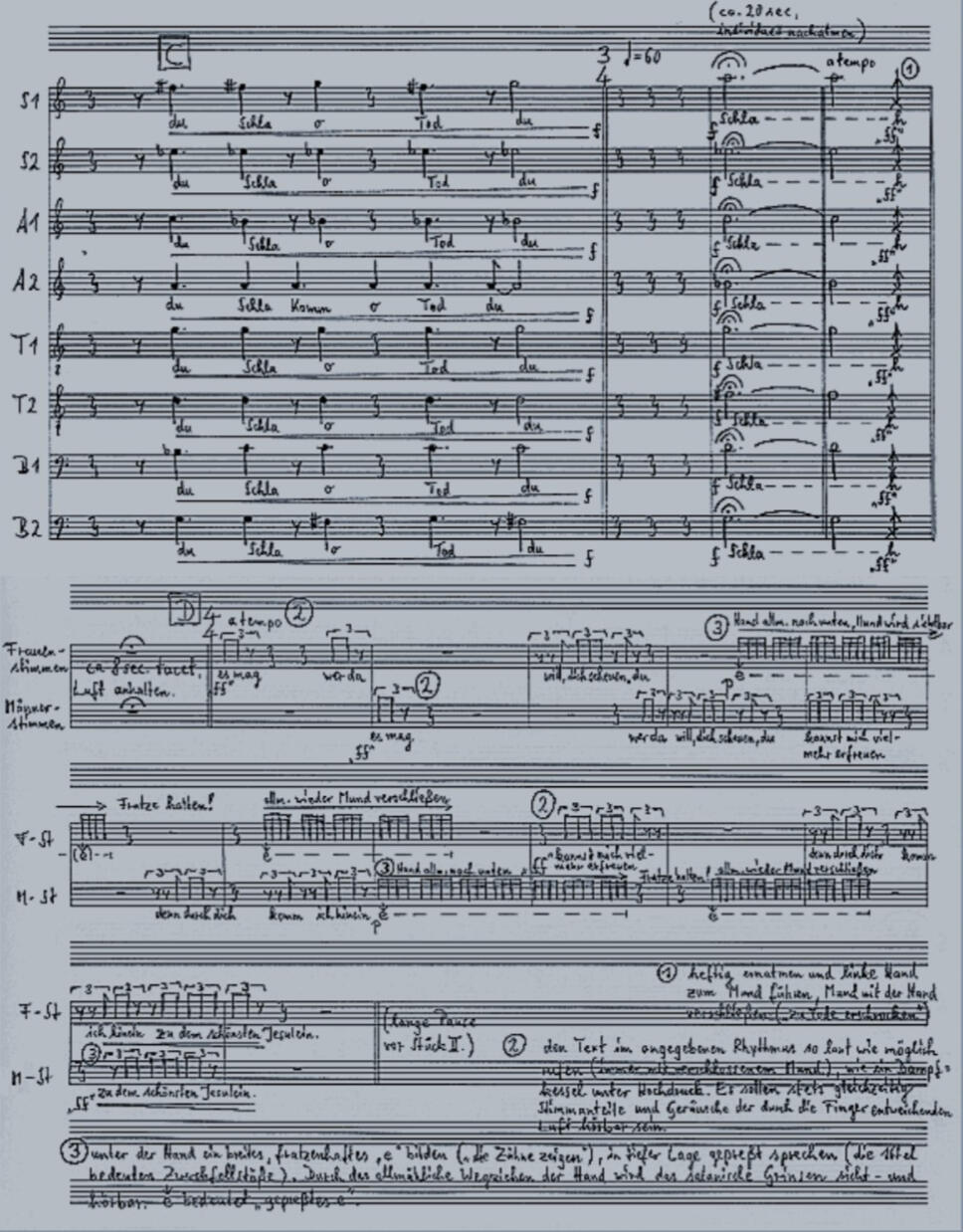
- der Tod als mathematisches Problem: Ein Gebiet der neueren Mathematik ist die fraktale Geometrie, wo unter anderem untersucht wird, wie sich Strukturen verhalten, wenn sie sehr oft nach immer der gleichen Regel abgebildet werden.
Das Faszinierende ist, daß man, auch wenn eine eindeutige Ausgangsstruktur und eine klar festgelegte Abbildungsregel vorliegt, nicht voraussagen kann, wie sich die Struktur verhalten wird. Manche Strukturen wuchern und vergrößern sich anscheinend unkontrollierbar, andere sterben einfach aus.
Ein wesentlicher Grundsatz der traditionellen Mathematik, die kausale Vorhersagbarkeit, wird also außer Kraft gesetzt, die einzige Möglichkeit, Gewißheit zu bekommen, ist, es auszuprobieren.
So schleichen sich durch die Hintertür der Zufall und die Ungewißheit sogar wieder in ein scheinbar so klares, gläsernes Gebäude wie das der Mathematik.
Neben diesem grundsätzlich interessanten Aspekt ist für meine Komposition vor allem das Phänomen der erwähnten ,,aussterbenden Strukturen" von Bedeutung.
Reinhard Karger
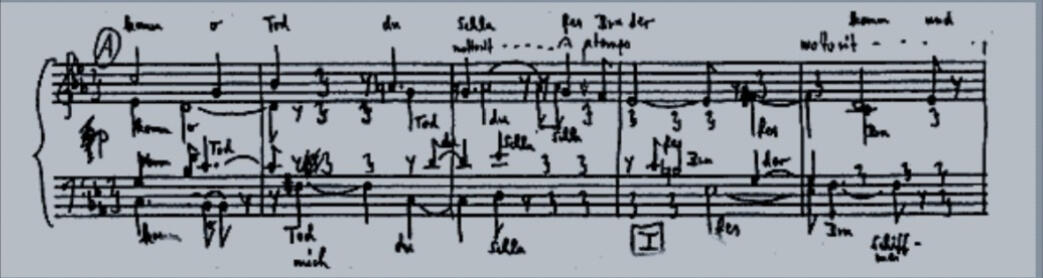
PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, Juni 1999NEUE MUSIK IN DER KIRCHEDer Blick zurück dominiert(...) Reinhard Kargers Stück für achtstimmigen Chor "Komm, o Tod, du Schlafes Bruder", die andere große Uraufführung des Abends, wirkt aufs Ganze gesehen eher statisch. Allerdings fächert der Kasseler Komponist die Todesthematik eindrucksvoll in zwei gegensätzliche Klang- und Ausdrucksebenen auf, eine grotesk-geräuschhafte "Beinhaus"-Musik und eine durch komplexe Akkordik bezeichnete "Entgrenzungsmusik" Beide Sphären durchdringen sich, ohne sich aufzulösen. Auch hier war Hans Darmstadt mit dem sehr engagierten Vokalensemble der Uraufführungsdirigent (...)
Werner Fritsch
La Vie c'est Ailleurs
- Hommage à Marcel Proust
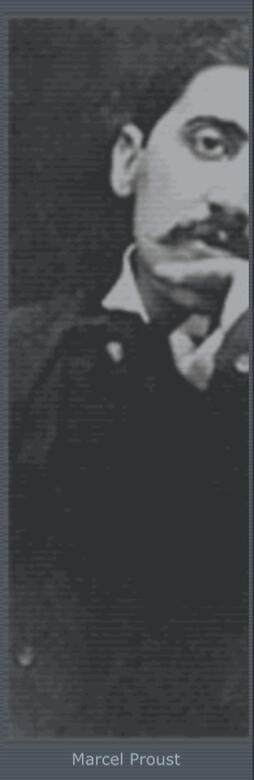
für Sopran, Violine, Kontrabaß, 2 Altsaxophone,
Posaune und Akkordeon1996 - 98HörprobeDie in der Komposition verwendeten Textsplitter entstammen einer Passage aus dem 4. Band von Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" - sie sollen jedoch innerhalb der Musik nicht als Sinnträger zur Geltung kommen, sondern fungieren als musikalische Paßwörter in eine Klangwelt, die ein Pendant zur Proust'schen Sprach- und Bilderwelt sucht.
So wie beim Lesen der "Suche nach der verlorenen Zeit" der lange Atem, das geduldige Umkreisen von scheinbar unbedeutenden Einzelheiten und die ekstatische Langsamkeit der Erzählweise einen gewaltigen Sog erzeugen, der mit fortschreitender Leseerfahrung immer stärker wird - so möchte die Musik den geneigten Hörer in einen Zustand verführen, der gleichzeitig von ,,Zugreifen" und ,,Loslassen" geprägt ist, den einzig sinnvollen Zustand ästhetischen Lernens: die paradoxe Einheit von Anspannung und Ruhe.Die 13 Musikstücke werden in der Aufführung ergänzt durch 4 reflektive Prosatexte von Verena Joos zur Proust'schen Bilder- und Gedankenwelt.Reinhard Karger, Kassel im März 1998Die Texte von Verena Joos zum Marcel Proust-Projekt

PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 8. Juli 1997MARCEL PROUSTQuelle tiefer Einsichten(...) In Verena Joos' Essay, den Helmut Mooshammer mit spürbar wachsendem Engagement las, erfährt der Hörer ihren Zugang zu Proust, und sie entdeckt in der Gestalt des Ich-Erzählers die Verbindung von Museum und Kirche, in ihren Gedanken Szenen mit den drei Bäumen auf.
Das ist dann auch die Quelle der Inspiration für Reinhard Kargers Komposition, für die er die exquisit variable Stimme der Sopranistin Traudl Schmaderer gewann. Kraft und Geschmeidigkeit verbinden sich mit ausdrucksvoller Schönheit in den Vokalisen, unvergleichlich im großen Soloteil, ganz dezent von der Violine Katrin Langes begleitet. Keinem Stil verpflichtet, gewinnt Kargers Komponieren die atmosphärische Dichte der Proust-Texte, zuweilen in' kunstvoller Eintönigkeit, aber auch elementar aufbrechend.
Das Ensemble ist vorzüglich besetzt mit Kerstin Mattem (Kontrabaß), Kathrin Vogler (Akkordeon), Thomas Krilleke und Karsten Pittner (Saxophon) und der virtuosen Posaunistin Bettina Köhler (...)
Bernd MüllmannHessische / Niedersächsische Allgemeine, 29. Januar 1998MARCEL PROUSTKlangmuster von Raum und ZeitMit außerordentlichem Interesse reagierte das Publikum auf ein ungewöhnliches Konzert-Projekt zu Texten von Marcel Proust im Sepulkralmuseum.KASSEL - Sehr zurückgenommen, mit Tendenz zum Pianissimo, setzt das Cello ein. In gleicher Zurückhaltung gesellt sich der Klang zweier Altsaxophone dazu. Einzelne Töne des Akkordeons verfremden diesen Klang, zusätzlich irritieren kurze Einwürfe der Posaune. Ebenfalls im Pianissimo übernimmt jetzt die Violine den Streicherpart.
Leicht und schwebend stehen klare Klangmuster im Raum, da erhebt sich eine Stimme, und wie ein Lichtstrahl legt sich der leuchtende Sopran der vorzüglichen Traudl Schmaderer darüber.
Langsam entwickeln die Musiker eine Folge von Tönen, die in ihrer Harmonik und rhythmischen Struktur zwar eine dissonante Spannung aufbauen, die im Grunde aber eine Art Ruhepunkt umkreisen, einholen, sich darauf niederlassen, besonders durch das wahre Nichts unendlicher Pausen.
"La vie c'est ailleurs" - übersetzt als "Das Leben ist woanders" - heißt das Werk, das Reflektionen zu Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" wiedergibt. Eine Komposition in Ton (Reinhard Karger) und Wort (Verena Joos), die auf ganz eigenwillige Weise sich der Proustschen Diktion mit seinen Schachtelsätzen, seinen Ziellosigkeiten, seiner Detailbesessenheit nähert. Mit allen diesen Formen spielen beide Künstler hervorragend, was besonders deutlich wird im Weglassen des bisherigen Proustschen Originalzitats und der Konzentration auf die spielerisch reflektierenden Texte der Ich-Erzählerin Verena Joos.
Scheint die Musik im Raum die Zeit anzuhalten, treiben die Texte im eigenen Umsichselbstdrehen die Zeit wieder voran. Text und Musik sind hier zwei unterschiedliche Ebenen, die erst im langsamen Daraufeinlassen, im eigenen Mitdenken beeindrucken.
Auf diesen besonderen Anspruch reagierte das Publikum mit außerordentlichem Interesse: Die Aufführung im Sepulkralmuseum war restlos ausverkauft.
Gabriele DoehringHessische / Niedersächsische Allgemeine, 28. Februar 2000URAUFFÜHRUNG
Ganz viel Zeit gelassenMit Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" setzten sich Reinhard Karger und Verena Joos kompositorisch und in Texten auseinander.KASSEL - Vieles ist nur in der Zeit erlebbar, so wie Musik. Für anderes muss man sich viel Zeit nehmen, etwa für Literatur. Einen besonders langen Atem benötigt man dabei für ein Werk, das selbst von und über Zeit handelt: Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit". Schnell mal an einem Wochenende durchlesen, geht nicht. Das dauert schon ein, zwei Jahre, wenn man's genau nimmt.
Erweist man danach tief beeindruckt diesem Werk eine sprachlich-musikalische Reverenz, braucht das auch Zeit. Zwei pausenlose Stunden am Freitag abend beanspruchten Verena Joos und Reinhard Karger dafür. Eine Zeit, die nicht alle Besucher der Uraufführung in der Martinskirche aufbringen wollten. Sie nahmen den Titel der Veranstaltung "La Vie c'est ailleurs - Das Leben ist woanders" offenbar wörtlich und eilten von dannen.
Wer aber in gelassener Ruhe sich auf das Dargebotene einließ, kam voll auf seine Kosten. Verena Joos trug vier selbst geschriebene Essays vor, eingebettet in zahlreiche musikalische Miniaturen von Reinhard Karger. Während die Texte, witzig-brillant wie erwartet, unterschiedliche Aspekte des Proustschen Kosmos bündelten, widmeten sich die Kompositionen einer einzigen Szene: dem Anblick einer Gruppe von drei Bäumen, die wie schemenhafte Wesen mystische Erinnerungen wachrufen. Heranschwebend verdichten sich die Töne der sechs Instrumente (Violine, Kontrabass, Akkordeon, Altsaxophon, Posaune), schließen sich erst nacheinander in der Zeit zu einem Gesamtgefüge zusammen. Die scharf konzentrierten, oft symmetrischen Strukturen steigern sich gemächlich und entschwinden ins Unfassbare. Der klare Sopran von Traudl Schmaderer fügt sich hier als zusätzliche Klangfarbe wunderbar in das Spektrum des Instrumentalensembles ein.
Anerkennender Applaus für einen ungewöhnlichen Kunstgenuss, für die exquisiten Solisten vom Staatstheaterorchester und für die nachempfindende musikalische Leitung von Hans Darmstadt.
Gabriele Doehring
La Vie c'est Ailleurs
- Hommage à Marcel Proust
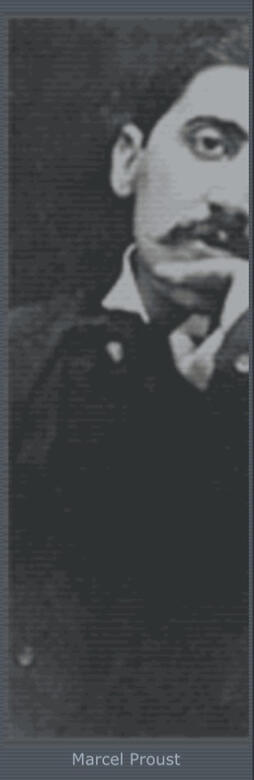
für Sopran, Violine, Kontrabaß, 2 Altsaxophone,
Posaune und Akkordeon1996 - 98HörprobeDie in der Komposition verwendeten Textsplitter entstammen einer Passage aus dem 4. Band von Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" - sie sollen jedoch innerhalb der Musik nicht als Sinnträger zur Geltung kommen, sondern fungieren als musikalische Paßwörter in eine Klangwelt, die ein Pendant zur Proust'schen Sprach- und Bilderwelt sucht.
So wie beim Lesen der "Suche nach der verlorenen Zeit" der lange Atem, das geduldige Umkreisen von scheinbar unbedeutenden Einzelheiten und die ekstatische Langsamkeit der Erzählweise einen gewaltigen Sog erzeugen, der mit fortschreitender Leseerfahrung immer stärker wird - so möchte die Musik den geneigten Hörer in einen Zustand verführen, der gleichzeitig von ,,Zugreifen" und ,,Loslassen" geprägt ist, den einzig sinnvollen Zustand ästhetischen Lernens: die paradoxe Einheit von Anspannung und Ruhe.Die 13 Musikstücke werden in der Aufführung ergänzt durch 4 reflektive Prosatexte von Verena Joos zur Proust'schen Bilder- und Gedankenwelt.Reinhard Karger, Kassel im März 1998Die Texte von Verena Joos zum Marcel Proust-Projekt

PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 8. Juli 1997MARCEL PROUSTQuelle tiefer Einsichten(...) In Verena Joos' Essay, den Helmut Mooshammer mit spürbar wachsendem Engagement las, erfährt der Hörer ihren Zugang zu Proust, und sie entdeckt in der Gestalt des Ich-Erzählers die Verbindung von Museum und Kirche, in ihren Gedanken Szenen mit den drei Bäumen auf.
Das ist dann auch die Quelle der Inspiration für Reinhard Kargers Komposition, für die er die exquisit variable Stimme der Sopranistin Traudl Schmaderer gewann. Kraft und Geschmeidigkeit verbinden sich mit ausdrucksvoller Schönheit in den Vokalisen, unvergleichlich im großen Soloteil, ganz dezent von der Violine Katrin Langes begleitet. Keinem Stil verpflichtet, gewinnt Kargers Komponieren die atmosphärische Dichte der Proust-Texte, zuweilen in' kunstvoller Eintönigkeit, aber auch elementar aufbrechend.
Das Ensemble ist vorzüglich besetzt mit Kerstin Mattem (Kontrabaß), Kathrin Vogler (Akkordeon), Thomas Krilleke und Karsten Pittner (Saxophon) und der virtuosen Posaunistin Bettina Köhler (...)
Bernd MüllmannHessische / Niedersächsische Allgemeine, 29. Januar 1998MARCEL PROUSTKlangmuster von Raum und ZeitMit außerordentlichem Interesse reagierte das Publikum auf ein ungewöhnliches Konzert-Projekt zu Texten von Marcel Proust im Sepulkralmuseum.KASSEL - Sehr zurückgenommen, mit Tendenz zum Pianissimo, setzt das Cello ein. In gleicher Zurückhaltung gesellt sich der Klang zweier Altsaxophone dazu. Einzelne Töne des Akkordeons verfremden diesen Klang, zusätzlich irritieren kurze Einwürfe der Posaune. Ebenfalls im Pianissimo übernimmt jetzt die Violine den Streicherpart.
Leicht und schwebend stehen klare Klangmuster im Raum, da erhebt sich eine Stimme, und wie ein Lichtstrahl legt sich der leuchtende Sopran der vorzüglichen Traudl Schmaderer darüber.
Langsam entwickeln die Musiker eine Folge von Tönen, die in ihrer Harmonik und rhythmischen Struktur zwar eine dissonante Spannung aufbauen, die im Grunde aber eine Art Ruhepunkt umkreisen, einholen, sich darauf niederlassen, besonders durch das wahre Nichts unendlicher Pausen.
"La vie c'est ailleurs" - übersetzt als "Das Leben ist woanders" - heißt das Werk, das Reflektionen zu Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" wiedergibt. Eine Komposition in Ton (Reinhard Karger) und Wort (Verena Joos), die auf ganz eigenwillige Weise sich der Proustschen Diktion mit seinen Schachtelsätzen, seinen Ziellosigkeiten, seiner Detailbesessenheit nähert. Mit allen diesen Formen spielen beide Künstler hervorragend, was besonders deutlich wird im Weglassen des bisherigen Proustschen Originalzitats und der Konzentration auf die spielerisch reflektierenden Texte der Ich-Erzählerin Verena Joos.
Scheint die Musik im Raum die Zeit anzuhalten, treiben die Texte im eigenen Umsichselbstdrehen die Zeit wieder voran. Text und Musik sind hier zwei unterschiedliche Ebenen, die erst im langsamen Daraufeinlassen, im eigenen Mitdenken beeindrucken.
Auf diesen besonderen Anspruch reagierte das Publikum mit außerordentlichem Interesse: Die Aufführung im Sepulkralmuseum war restlos ausverkauft.
Gabriele DoehringHessische / Niedersächsische Allgemeine, 28. Februar 2000URAUFFÜHRUNG
Ganz viel Zeit gelassenMit Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" setzten sich Reinhard Karger und Verena Joos kompositorisch und in Texten auseinander.KASSEL - Vieles ist nur in der Zeit erlebbar, so wie Musik. Für anderes muss man sich viel Zeit nehmen, etwa für Literatur. Einen besonders langen Atem benötigt man dabei für ein Werk, das selbst von und über Zeit handelt: Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit". Schnell mal an einem Wochenende durchlesen, geht nicht. Das dauert schon ein, zwei Jahre, wenn man's genau nimmt.
Erweist man danach tief beeindruckt diesem Werk eine sprachlich-musikalische Reverenz, braucht das auch Zeit. Zwei pausenlose Stunden am Freitag abend beanspruchten Verena Joos und Reinhard Karger dafür. Eine Zeit, die nicht alle Besucher der Uraufführung in der Martinskirche aufbringen wollten. Sie nahmen den Titel der Veranstaltung "La Vie c'est ailleurs - Das Leben ist woanders" offenbar wörtlich und eilten von dannen.
Wer aber in gelassener Ruhe sich auf das Dargebotene einließ, kam voll auf seine Kosten. Verena Joos trug vier selbst geschriebene Essays vor, eingebettet in zahlreiche musikalische Miniaturen von Reinhard Karger. Während die Texte, witzig-brillant wie erwartet, unterschiedliche Aspekte des Proustschen Kosmos bündelten, widmeten sich die Kompositionen einer einzigen Szene: dem Anblick einer Gruppe von drei Bäumen, die wie schemenhafte Wesen mystische Erinnerungen wachrufen. Heranschwebend verdichten sich die Töne der sechs Instrumente (Violine, Kontrabass, Akkordeon, Altsaxophon, Posaune), schließen sich erst nacheinander in der Zeit zu einem Gesamtgefüge zusammen. Die scharf konzentrierten, oft symmetrischen Strukturen steigern sich gemächlich und entschwinden ins Unfassbare. Der klare Sopran von Traudl Schmaderer fügt sich hier als zusätzliche Klangfarbe wunderbar in das Spektrum des Instrumentalensembles ein.
Anerkennender Applaus für einen ungewöhnlichen Kunstgenuss, für die exquisiten Solisten vom Staatstheaterorchester und für die nachempfindende musikalische Leitung von Hans Darmstadt.
Gabriele Doehring
Music projects
free musical projects
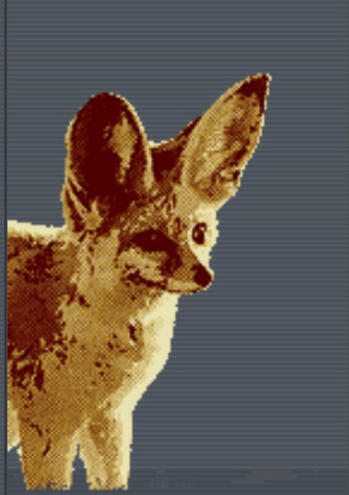
Vienna Remix Hsinchu
for 10 actors/musicians2019
New Pipa
An intercultural composition project with
Huikuan Lin (Pipa), Gary Wu (Bamboo Flute),
Pacific Quartet Vienna and
composition students of the mdw Vienna
2014/15
Teufelspakte (pacts with the devil)
or: Five ways to sell your soul
details (in German)
a music theatre collage,
developped and performed by students of
Fachrichtung Musik at Universität Kassel
directed by Prof. Reinhard Karger
2005/2006
Die Orchesterprobe (the orchestra rehearsal)
details (in German)
music theatre by Verena Joos and Reinhard Karger
2004/2005
adorno – a concert
details (in German)
(with Michaela Ehinger, Marcel Daemgen,
Christoph Korn and Wolfgang Stryi)
2003
cosmic comix (together with Olaf Pyras)
details (in German)
for voice and snare drum
2001/02
Response 2001 (educational composition project)
Essen
2001
SMS - short music stories (together with Wolfgang Stryi)
Hörprobedetails (in German)
for voice, alto saxophone and bass clarinet
2001
Response 2000 (educational composition project)
Frankfurt
1999/2000
SprechStücke (ensemble GhK)
Kassel
1999/2000
Ohrenöffner (music performance for children
Kandern
1999
Im Eis (radio play with music)
(together with Bernd Gieseking and Günther Staniewski)
Minden
1999
Seul, en train de ... (together with Wolfgang Stryi)
Hörprobedetails (in German)
for voice and double bass clarinet
1998/99
Response 98 (educational composition project)
Frankfurt 1998
MundWerk 1-13 for voice and microphone
1997/98
Response 96 (educational composition project)
Frankfurt
1996
Response 94 (educational composition project)
Frankfurt
1994
Musikprojekte
freie Musikprojekte
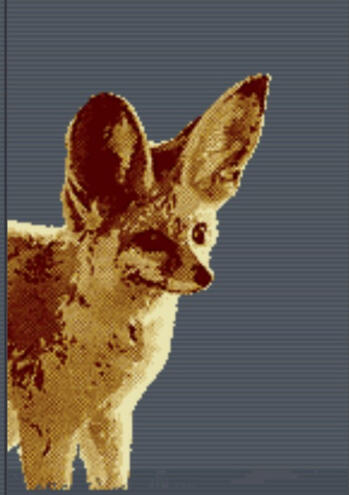
Vienna Remix Hsinchu
für 10 Darsteller/Musiker
2019
New Pipa
ein interkulturelles Kompositionsprojekt mit
Huikuan Lin (Pipa), Gary Wu (Bambusflöte),
dem Pacific Quartet Vienna und
Studierenden der mdw Wien
2014/15
Teufelspakte
oder: Fünf Arten, seine Seele zu verkaufen
eine musikalisch-szenische Collage,
entwickelt und vorgestellt von Studierenden
der Fachrichtung Musik an der Universität Kassel
unter der Leitung von Prof. Reinhard Karger
2005/2006
Die Orchesterprobe
Musiktheater von Verena Joos und Reinhard Karger
adorno – ein konzert
(mit Michaela Ehinger, Marcel Daemgen,
Christoph Korn und Wolfgang Stryi)
2003
cosmic comix (zus. mit Olaf Pyras)
für Stimme und Snare Drum
2001/02
Response 2001 (Komponieren mit Schülern)
Essen
2001
SMS - short music stories (zus. mit Wolfgang Stryi)
für Stimme, Altsaxophon und Baßklarinette
2001
Response 2000 (Komponieren mit Schülern)
Frankfurt
1999/2000
SprechStücke (ensemble GhK)
Kassel
1999/2000
Ohrenöffner (Musikaktion für Kinder)
Kandern
1999
Im Eis - Hörspiel mit Musik
(zus. mit Bernd Gieseking und Günther Staniewski)
Minden
1999
Seul, en train de ... (zus. mit Wolfgang Stryi)
für Stimme und Kontrabaßklarinette
1998/99
Response 98 (Komponieren mit Schülern)
Frankfurt 1998
MundWerk 1-13 für Stimme und Mikrophon
1997/98
Response 96 (Komponieren mit Schülern)
Frankfurt
1996
Response 94(Komponieren mit Schülern)
Frankfurt
1994
Music projects
Bands

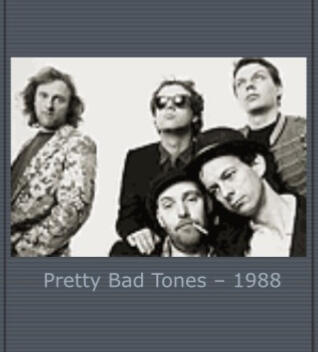
Sparbier Band Kassel
1992–1997
concert projects (experimental rock music)
Abrar Osman and Sparbier Band 1995
Winterreise (Sparbier – J. Berger) 1994
Eine Winterreise – a winter journey
(Sparbier – Schiffers – Osman) 1994
Schlemihl (Chamisso/Joos) 1993
Pretty Bad Tones Kassel
1986–1991Rhythm-and-Blues-Band
Hugo Scholz - Gesang, Saxophone, Blues-Harp
Didi Wilhelm – Baß
Gecko Koch – Gitarre Michael Rappold – Schlagzeug
Reinhard Karger – Keyboards
Musikprojekte
Bands

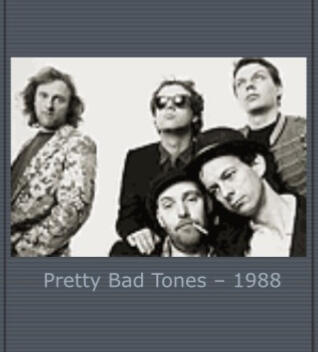
Sparbier Band Kassel
1992–1997
diverse Konzertprogramme (experimentelle Rockmusik)
Abrar Osman und Sparbier Band 1995
Winterreise (Sparbier – J. Berger) 1994
Eine Winterreise – a winter journey
(Sparbier – Schiffers – Osman) 1994
Schlemihl (Chamisso/Joos) 1993
Pretty Bad Tones Kassel
1986–1991Rhythm-and-Blues-Band
Hugo Scholz - Gesang, Saxophone, Blues-Harp
Didi Wilhelm – Baß
Gecko Koch – Gitarre Michael Rappold – Schlagzeug
Reinhard Karger – Keyboards
bands
Sparbier Band
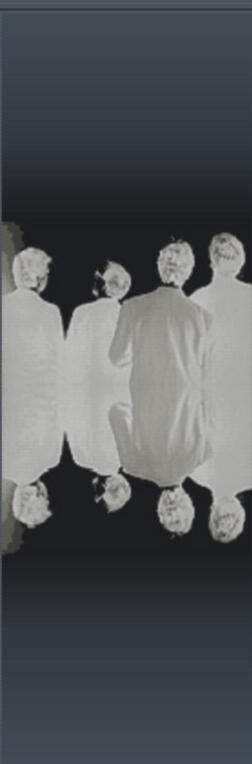
1992-1997Die Sparbier Band:
Reinhard Karger - Stimme + Keyboard, Jürgen Wehner - Gitarre,
Tilman Scheer - Marimba, Olaf Pyras - SchlagwerkDer Sparbier Band ist alles Material, was klingt, und nichts läßt sie so, wie es ist.
Eine Band - vier Musiker. Ihnen allen ist gemein eine klassische Ausbildung an ihren Instrumenten bzw./und in Komposition und gleichzeitig die Liebe zur Popmusik, die sich in jahrelanger Banderfahrung widerspiegelt. Wie gesagt: eine Gleichzeitigkeit, keine Hierarchie. Von dieser Gleichzeitigkeit der – nennen wir es ein erstes und letztes Mal – E- und U-Musik, zur Verwobenheit, zum vitalen und fruchtbaren Dialog bedurfte es eines kleinen und doch bedeutsamen Schrittes, den die Gründung der Sparbier Band im documenta-Jahr 1992 markiert. "Zwischen den Stilen" hieß denn auch, programmatisch bündelnd, ihr erstes Konzert.
Wenig später sind das Musiktheater "Schlemihl oder Der Mann ohne Schatten" nach Adelbert von Chamissos Novelle entstanden (mit der Schauspielerin Sabine Wackernagel), ein Konzert mit dem eritreischen Dichter und Musiker Abrar Osman und schließlich ein "Winterreise-Projekt" mit Osman und der Sängerin Asmera Berhane. Zwischen dem romantischen Gesang, der, um mit Roland Barthes zu sprechen, "immer wieder die Erschütterung des verlorenen, verlassenen Subjekts singt", und Osmans Liedern vom Verlust der Heimat bildeten hier die bemerkenswerten Arrangements der Sparbier Band die Brücke über Zeiten und Kontinente.Verena Joos
Ein Projekt der Sparbier Band
Winterreise
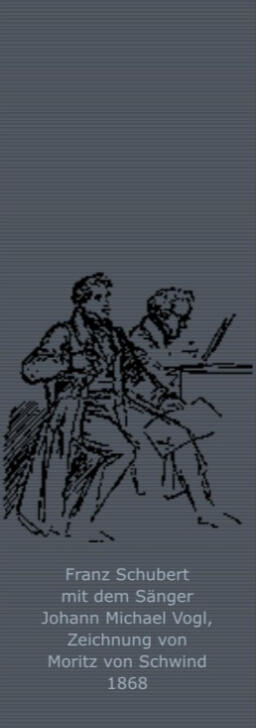
für Sänger und Combo
1994Um die Grundstimmung der "Winterreise" neu und "unerhört" zu hören, bedarf sie einer "Transposition". Die Sparbier Band instrumentiert sie für Marimba, E-Gitarre, Schlagwerk, Keyboards' in den Farben der Pop-Musik also. Der Status reiner Begleitung wird überwunden, die Hierarchie von Stimme und Instrument außer Kraft gesetzt. Bisweilen schwebt die Liedmelodie nackt über Geräuschimprovisationen, zwischen einzelne Blöcke von Liedern drängen immer wieder Instrumentalimprovisationen, die sich von Bildern und Situationen modernen Lebensgefühls herleiten: Klanglandschaften, in die sich der romantische Gestus zitatenhaft eindrängt.
Die Lieder folgen nicht der im Zyklus festgeschriebenen Reihung; die Schubertsche Kreisbewegung wird von einer neuen Dramaturgie abgelöst. Was schon im Entstehungsprozeß der "Winterreise" vor bald 170 Jahren eher zufällig war - der Dichter Wilhelm Müller lieferte seine Texte in zwei "Portionen", die entscheidende Vorgabe für Schuberts Chronologie -, hat sich durch das zelebratorische Insistieren zur Unabänderlichkeit sklerotisiert. Man weiß immer, "was als nächstes kommt" - und enthebt sich dadurch des Momentes der Überraschung, der Überrumpelung. Eine neue Nachbarschaft mag geeignet sein, den Liedern die Dignität des "Schauerlichen", von dem Schubert anläßlich ihrer ersten Präsentation im Freundeskreis gesprochen hat, wiederzuschenken.
Neumontage des Zyklus, Eingriffe in die Struktur, die Suche nach "unsängerischen" Darstellungsformen, Pop-Arrangement und lmprovisationselemente - was bleibt da von Schuberts Opus noch übrig? Um es mit einem großen Wort zu sagen:
der Geist seiner musikalischen Bilder. Durch Entfremdung gelangt die Sparbier Band jenem Gefühl von Fremdheit wieder näher, das der Zyklus zum Thema hat, das allerdings durch Akkomodation an Publikumsgeschmack und Sängereitelkeit lange Zeit einem Gefühl falscher Vertrautheit Platz machen mußte.Verena JoosPRESSE zur "Winterreise"Westfälische Nachrichten , 29. November 1994(...) Am letzten Tag der "Neuen Musik in Münster" betrieb man die Demontage der Schubertschen "Winterreise" - oder genauer: der altbekannten Aufführungstradition. Die aus Kassel angereiste Sparbier Band verschlug es in den Kornspeicher im münsterschen Hafen, mitten zwischen gekalkte Wände und Walzhafersäcke ,,50 kg netto", unter mehlbestäubte Holzbalken und in feucht-kaltes Klima.: Alles Gift für ein Meisterkonzert-Publikum, das "seine" "Winterreise" - am besten noch von einem Starsänger - zelebriert wissen will. Meint jedenfalls die Sparbier Band und schickt sich an, dem Liederzyklus das "Schauerliche" wieder zurückzugeben. Nicht mittels eines Hammerflügels, nein: mit Keyboards, Marimbaphon, E-Gitarre und Schlagwerk haucht das Quartett dem Kunstwerk neues Leben ein. Konsequenterweise wird die traditionelle Klavierbegleitung aufgelöst, zum Geräuschhaften, verschwindet mal fast ganz und läßt den Sänger allein. Zwischen den Liedblöcken entstehen improvisierte Bilder, die sich des Schubertschen Materials bedienen. Das war eine "unerhörte" Version in abenteuerlicher Umgebung. Gegen kalte Füße und tropfende Nasen half dankenswerterweise der westfälische Doppelkorn an der Abendkasse (...)
Christoph W. Schulte im WaldeFrankfurter Allgemeine Zeitung, 5. Januar 1995(...) Man wollte der erworbenen Vertrautheit entgegensteuern, die genau das Gegenteil von Inhalt und Stimmung der Winterreise ist. So kann erst wieder die Verfremdung vom Gewohnten befreien und den Blick entromantisierend für eine Sicht des eigentlichen Kerns schärfen. Erst die Bearbeitung bahnt den Weg zurück zum Original.
Die 1992 in Kassel gegründete "Sparbier Band" hat das Schubert-Werk mit Keyboards, Schlagwerk, Marimbaphon und E-Gitarre uminstrumentiert. Der Name des vierköpfigen Ensembles, abgeleitet von Wim Thoelkes unvergessenem Glücksboten Walter Sparbier, gleichzeitig Sinnbild der von Glamour befreiten Alltagswelt, weist bereits in die künstlerische Richtung der klassisch ausgebildeten Musiker: Kunst, vom Alltäglichen genährt, doch ihrer alltäglichen Umgebung enthoben und so zu einer neuen künstlerischen Eigenständigkeit geführt. So präsentierte die Formation Schuberts Lieder neu gruppiert - teils als Geräuschimprovisationen, teils als die Originalmelodie aufnehmende Gesangspassagen (mit dem Schauspieler und Sänger Joachim Berger) mit einem Instrumentarium aus der Rockmusik. Auch wenn der romantische Gestus zitiert wird, ist das Werk keineswegs romantisch. So ist dieses mit dem Kulturförderpreis der Stadt Kassel 1994 ausgezeichnete Arrangement mehr als ein modernisierter Schubert, denn das Wesentliche bleibt erhalten: Die Fremdheit lugt aus jedem Takt. In Münster hat man den Verfremdungseffekte noch verstärkt Aufführungsort war ein erstmals als Konzertstätte genutzter Kornspeicher (...)
Sabine Kreter
bands
Sparbier Band
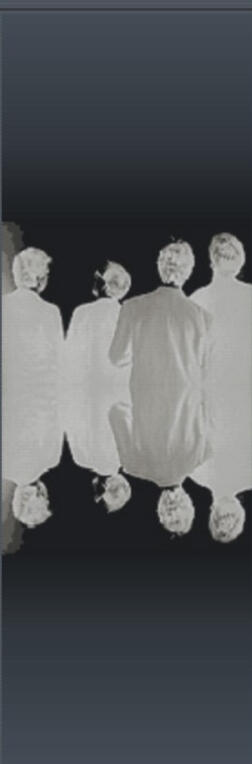
1992-1997Die Sparbier Band:
Reinhard Karger - Stimme + Keyboard, Jürgen Wehner - Gitarre,
Tilman Scheer - Marimba, Olaf Pyras - SchlagwerkDer Sparbier Band ist alles Material, was klingt, und nichts läßt sie so, wie es ist.
Eine Band - vier Musiker. Ihnen allen ist gemein eine klassische Ausbildung an ihren Instrumenten bzw./und in Komposition und gleichzeitig die Liebe zur Popmusik, die sich in jahrelanger Banderfahrung widerspiegelt. Wie gesagt: eine Gleichzeitigkeit, keine Hierarchie. Von dieser Gleichzeitigkeit der – nennen wir es ein erstes und letztes Mal – E- und U-Musik, zur Verwobenheit, zum vitalen und fruchtbaren Dialog bedurfte es eines kleinen und doch bedeutsamen Schrittes, den die Gründung der Sparbier Band im documenta-Jahr 1992 markiert. "Zwischen den Stilen" hieß denn auch, programmatisch bündelnd, ihr erstes Konzert.
Wenig später sind das Musiktheater "Schlemihl oder Der Mann ohne Schatten" nach Adelbert von Chamissos Novelle entstanden (mit der Schauspielerin Sabine Wackernagel), ein Konzert mit dem eritreischen Dichter und Musiker Abrar Osman und schließlich ein "Winterreise-Projekt" mit Osman und der Sängerin Asmera Berhane. Zwischen dem romantischen Gesang, der, um mit Roland Barthes zu sprechen, "immer wieder die Erschütterung des verlorenen, verlassenen Subjekts singt", und Osmans Liedern vom Verlust der Heimat bildeten hier die bemerkenswerten Arrangements der Sparbier Band die Brücke über Zeiten und Kontinente.Verena Joos
Ein Projekt der Sparbier Band
Winterreise
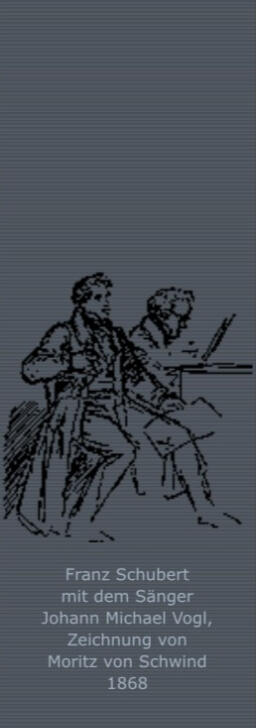
für Sänger und Combo
1994Um die Grundstimmung der "Winterreise" neu und "unerhört" zu hören, bedarf sie einer "Transposition". Die Sparbier Band instrumentiert sie für Marimba, E-Gitarre, Schlagwerk, Keyboards' in den Farben der Pop-Musik also. Der Status reiner Begleitung wird überwunden, die Hierarchie von Stimme und Instrument außer Kraft gesetzt. Bisweilen schwebt die Liedmelodie nackt über Geräuschimprovisationen, zwischen einzelne Blöcke von Liedern drängen immer wieder Instrumentalimprovisationen, die sich von Bildern und Situationen modernen Lebensgefühls herleiten: Klanglandschaften, in die sich der romantische Gestus zitatenhaft eindrängt.
Die Lieder folgen nicht der im Zyklus festgeschriebenen Reihung; die Schubertsche Kreisbewegung wird von einer neuen Dramaturgie abgelöst. Was schon im Entstehungsprozeß der "Winterreise" vor bald 170 Jahren eher zufällig war - der Dichter Wilhelm Müller lieferte seine Texte in zwei "Portionen", die entscheidende Vorgabe für Schuberts Chronologie -, hat sich durch das zelebratorische Insistieren zur Unabänderlichkeit sklerotisiert. Man weiß immer, "was als nächstes kommt" - und enthebt sich dadurch des Momentes der Überraschung, der Überrumpelung. Eine neue Nachbarschaft mag geeignet sein, den Liedern die Dignität des "Schauerlichen", von dem Schubert anläßlich ihrer ersten Präsentation im Freundeskreis gesprochen hat, wiederzuschenken.
Neumontage des Zyklus, Eingriffe in die Struktur, die Suche nach "unsängerischen" Darstellungsformen, Pop-Arrangement und lmprovisationselemente - was bleibt da von Schuberts Opus noch übrig? Um es mit einem großen Wort zu sagen:
der Geist seiner musikalischen Bilder. Durch Entfremdung gelangt die Sparbier Band jenem Gefühl von Fremdheit wieder näher, das der Zyklus zum Thema hat, das allerdings durch Akkomodation an Publikumsgeschmack und Sängereitelkeit lange Zeit einem Gefühl falscher Vertrautheit Platz machen mußte.Verena JoosPRESSE zur "Winterreise"Westfälische Nachrichten , 29. November 1994(...) Am letzten Tag der "Neuen Musik in Münster" betrieb man die Demontage der Schubertschen "Winterreise" - oder genauer: der altbekannten Aufführungstradition. Die aus Kassel angereiste Sparbier Band verschlug es in den Kornspeicher im münsterschen Hafen, mitten zwischen gekalkte Wände und Walzhafersäcke ,,50 kg netto", unter mehlbestäubte Holzbalken und in feucht-kaltes Klima.: Alles Gift für ein Meisterkonzert-Publikum, das "seine" "Winterreise" - am besten noch von einem Starsänger - zelebriert wissen will. Meint jedenfalls die Sparbier Band und schickt sich an, dem Liederzyklus das "Schauerliche" wieder zurückzugeben. Nicht mittels eines Hammerflügels, nein: mit Keyboards, Marimbaphon, E-Gitarre und Schlagwerk haucht das Quartett dem Kunstwerk neues Leben ein. Konsequenterweise wird die traditionelle Klavierbegleitung aufgelöst, zum Geräuschhaften, verschwindet mal fast ganz und läßt den Sänger allein. Zwischen den Liedblöcken entstehen improvisierte Bilder, die sich des Schubertschen Materials bedienen. Das war eine "unerhörte" Version in abenteuerlicher Umgebung. Gegen kalte Füße und tropfende Nasen half dankenswerterweise der westfälische Doppelkorn an der Abendkasse (...)
Christoph W. Schulte im WaldeFrankfurter Allgemeine Zeitung, 5. Januar 1995(...) Man wollte der erworbenen Vertrautheit entgegensteuern, die genau das Gegenteil von Inhalt und Stimmung der Winterreise ist. So kann erst wieder die Verfremdung vom Gewohnten befreien und den Blick entromantisierend für eine Sicht des eigentlichen Kerns schärfen. Erst die Bearbeitung bahnt den Weg zurück zum Original.
Die 1992 in Kassel gegründete "Sparbier Band" hat das Schubert-Werk mit Keyboards, Schlagwerk, Marimbaphon und E-Gitarre uminstrumentiert. Der Name des vierköpfigen Ensembles, abgeleitet von Wim Thoelkes unvergessenem Glücksboten Walter Sparbier, gleichzeitig Sinnbild der von Glamour befreiten Alltagswelt, weist bereits in die künstlerische Richtung der klassisch ausgebildeten Musiker: Kunst, vom Alltäglichen genährt, doch ihrer alltäglichen Umgebung enthoben und so zu einer neuen künstlerischen Eigenständigkeit geführt. So präsentierte die Formation Schuberts Lieder neu gruppiert - teils als Geräuschimprovisationen, teils als die Originalmelodie aufnehmende Gesangspassagen (mit dem Schauspieler und Sänger Joachim Berger) mit einem Instrumentarium aus der Rockmusik. Auch wenn der romantische Gestus zitiert wird, ist das Werk keineswegs romantisch. So ist dieses mit dem Kulturförderpreis der Stadt Kassel 1994 ausgezeichnete Arrangement mehr als ein modernisierter Schubert, denn das Wesentliche bleibt erhalten: Die Fremdheit lugt aus jedem Takt. In Münster hat man den Verfremdungseffekte noch verstärkt Aufführungsort war ein erstmals als Konzertstätte genutzter Kornspeicher (...)
Sabine Kreter
Musiktheater
Vienna Remix Hsinchu
a music theatre experiment 2019conception for the workshop September 23-27 2019 in Hsinchu:As basic material we use three short musical fragments (from Radetzkymarsch, Eine kleine Nachtmusik, Einer hat immer das Bummerl), three sounds (Pummerin - the largest bell of the Stephansdom, Fiaker, Prater) and one sentence (im Prater blühn wieder die Bäume) that are typical, well-known signations for Vienna ...
as well as the same amount of signations from Taiwan collected by the participating students.

By means of vocal and instrumental improvisation, by analysing and deconstructing the melodic, rhythmic and harmonic features of our material and by translating the text fragments from German to Chinese and vice versa we would try to remix the basic elements and formulate a new structure that reflects both places.Also movement and even costumes could be included into this concept (a baroque wig, a historical walking stick could be elements to play with from the Viennese side...), the dramaturgy and the „story“ we would invent together would depend on the place we would be working in.April 2019, Reinhard Karger

Musiktheater
Vienna Remix Hsinchu
a music theatre experiment 2019conception for the workshop September 23-27 2019 in Hsinchu:As basic material we use three short musical fragments (from Radetzkymarsch, Eine kleine Nachtmusik, Einer hat immer das Bummerl), three sounds (Pummerin - the largest bell of the Stephansdom, Fiaker, Prater) and one sentence (im Prater blühn wieder die Bäume) that are typical, well-known signations for Vienna ...
as well as the same amount of signations from Taiwan collected by the participating students.

By means of vocal and instrumental improvisation, by analysing and deconstructing the melodic, rhythmic and harmonic features of our material and by translating the text fragments from German to Chinese and vice versa we would try to remix the basic elements and formulate a new structure that reflects both places.Also movement and even costumes could be included into this concept (a baroque wig, a historical walking stick could be elements to play with from the Viennese side...), the dramaturgy and the „story“ we would invent together would depend on the place we would be working in.April 2019, Reinhard Karger

music theatre
Teufelspakte
oder:
Fünf Arten, seine Seele zu verkaufen
2005/2006eine musikalisch-szenische Collage,
entwickelt und vorgestellt von Studierenden
der Fachrichtung Musik an der Universität Kassel
unter der Leitung von Prof. Reinhard KargerPRESSEpublik, Juli 2006Teufelspakte, lustvoll präsentiertDie Konzertreihe "Soundcheck" startete mit fulminantem SpektakelDer Eulensaal ist nicht nur ein exzellenter Bibliotheks- und Vortragsraum, auch als Theatersaal weist er unbestreitbar hohe atmosphärische und akustische Qualitäten auf. Reinhard Karger, Professor der Fachrichtung Musik und als solcher zuständig für künstlerische Projekte, hat ihn, zur Premiere seiner Reihe "Soundcheck", zum Schauplatz gleich zweier theatralischer Spektakel gemacht. "Teufelspakte" hieß das erste, eine musikalisch-szenische Collage, entwickelt für und mit Studenten des Fachbereichs.

Gut für satanischen Seelenverkauf. Hinten vlnr: Alexander Pluquett, Jochen Gros, Andreas Kaufmann, Thilo Nordheim. Vorne vlnr: Simone Waldrich, Teresa Kahlert, Annekathrin Inder, Lara Steingrube. Nicht im Bild: Dorothee Brehl.Alternierend zwischen virtuosem Solo und gekonnter chorischer Interaktion, präsentierte das neunköpfige Ensemble fünf satanische Varianten des Seelenverkaufs, von der barocken Ballade bis hin zur Ernst-Jandl-Adaption – ein teuflisches Kabinettstück, dessen Gelingen heftig bejubelt wurde. Eine Ouvertüre nach Maß, die vortrefflich auf den sechsten Teufelspakt einstimmte: "Die Geschichte vom Soldaten", Musiktheater von Charles F. Ramuz und Igor Strawinsky. Die Besetzung dieser prallen, Varietéatmosphäre ausstrahlenden, technisch allen Akteuren enorm viel abverlangende "Brettl-Oper" stellte, programmatisch für das Soundcheck-Konzept, eine gelungene Vernetzung diverser Gruppen dar. Im Orchester (Leitung: Andreas Cessak) mischten sich Lehrende der Fachrichtung Musik (Stefan Hülsermann, Klarinette; German Marstatt, Trompete; Olaf Pyras, Schlagzeug) mit Musikern aus dem Orchester des Staatstheaters zu einem beglückend homogenen Gesamtklang. Das Schauspielensemble (Regie: Reinhard Karger) setzte sich zusammen aus ehemaligen und aktuell Studierenden und einer professionellen Schauspielerin: Anja Haverland, welche den Part des Erzählers wohltuend mit rollenkompatibler Emotion auflud und so raffiniert den schneidigen "Ernst-Busch-Ton" vermied, der uns so oft von CD-Einspielungen entgegen quäkt. Susanne Schulz bezauberte als augenzwinkernd eitle Prinzessin, Timm Reitinger imponierte als leidend-kämpfender Soldat und Alexander Pluquett zeigte als teuflischer Irrwisch eine theatralisch wie akrobatisch gleichermaßen bewundernswerte Leistung. Ein dreimal trotz Fußballweltmeisterschaft prall gefüllter Saal bewies: Soundcheck hat sein Publikum gefunden.
Musiktheater
Teufelspakte
oder:
Fünf Arten, seine Seele zu verkaufen
2005/2006eine musikalisch-szenische Collage,
entwickelt und vorgestellt von Studierenden
der Fachrichtung Musik an der Universität Kassel
unter der Leitung von Prof. Reinhard KargerPRESSEpublik, Juli 2006Teufelspakte, lustvoll präsentiertDie Konzertreihe "Soundcheck" startete mit fulminantem SpektakelDer Eulensaal ist nicht nur ein exzellenter Bibliotheks- und Vortragsraum, auch als Theatersaal weist er unbestreitbar hohe atmosphärische und akustische Qualitäten auf. Reinhard Karger, Professor der Fachrichtung Musik und als solcher zuständig für künstlerische Projekte, hat ihn, zur Premiere seiner Reihe "Soundcheck", zum Schauplatz gleich zweier theatralischer Spektakel gemacht. "Teufelspakte" hieß das erste, eine musikalisch-szenische Collage, entwickelt für und mit Studenten des Fachbereichs.

Gut für satanischen Seelenverkauf. Hinten vlnr: Alexander Pluquett, Jochen Gros, Andreas Kaufmann, Thilo Nordheim. Vorne vlnr: Simone Waldrich, Teresa Kahlert, Annekathrin Inder, Lara Steingrube. Nicht im Bild: Dorothee Brehl.Alternierend zwischen virtuosem Solo und gekonnter chorischer Interaktion, präsentierte das neunköpfige Ensemble fünf satanische Varianten des Seelenverkaufs, von der barocken Ballade bis hin zur Ernst-Jandl-Adaption – ein teuflisches Kabinettstück, dessen Gelingen heftig bejubelt wurde. Eine Ouvertüre nach Maß, die vortrefflich auf den sechsten Teufelspakt einstimmte: "Die Geschichte vom Soldaten", Musiktheater von Charles F. Ramuz und Igor Strawinsky. Die Besetzung dieser prallen, Varietéatmosphäre ausstrahlenden, technisch allen Akteuren enorm viel abverlangende "Brettl-Oper" stellte, programmatisch für das Soundcheck-Konzept, eine gelungene Vernetzung diverser Gruppen dar. Im Orchester (Leitung: Andreas Cessak) mischten sich Lehrende der Fachrichtung Musik (Stefan Hülsermann, Klarinette; German Marstatt, Trompete; Olaf Pyras, Schlagzeug) mit Musikern aus dem Orchester des Staatstheaters zu einem beglückend homogenen Gesamtklang. Das Schauspielensemble (Regie: Reinhard Karger) setzte sich zusammen aus ehemaligen und aktuell Studierenden und einer professionellen Schauspielerin: Anja Haverland, welche den Part des Erzählers wohltuend mit rollenkompatibler Emotion auflud und so raffiniert den schneidigen "Ernst-Busch-Ton" vermied, der uns so oft von CD-Einspielungen entgegen quäkt. Susanne Schulz bezauberte als augenzwinkernd eitle Prinzessin, Timm Reitinger imponierte als leidend-kämpfender Soldat und Alexander Pluquett zeigte als teuflischer Irrwisch eine theatralisch wie akrobatisch gleichermaßen bewundernswerte Leistung. Ein dreimal trotz Fußballweltmeisterschaft prall gefüllter Saal bewies: Soundcheck hat sein Publikum gefunden.
music theatre
Die Orchesterprobe
Musiktheater von
Verena Joos und Reinhard Karger
2004/2005Die Orchesterprobe - Genese einer IdeeIch habe lange Jahre meines Arbeitslebens in Theatern verbracht, und von Anfang an hat mich besonders der Orchesterapparat fasziniert, nicht nur als Generator schöner und furchterregender Klänge, sondern auch als geschützter Lebensraum, in dem sich Menschen und Schwingungen auf einzigartige Weise begegnen. Wie ist es möglich, dass ein schlecht gelaunter Fagottist, der eben noch in der Kantine die übelsten Zoten gerissen hat, zehn Minuten später durch sein Spiel den edelsten Gefühlen Gestalt verleiht und das Publikum zu Tränen rührt? Was ist das für eine seltsame Gesellschaft, in der sich die verschiedenen Individuen und Interessengruppen genau wie im „richtigen Leben“ gegenseitig bekämpfen, und die doch übereinkommt, sich so zu disziplinieren, dass eine Botschaft über die Rampe oder aus dem Graben kommt, die alle Widersprüche aufhebt?
Früh wurde die Idee geboren, diesen modellhaften Kosmos mit all seinen grotesken und poetischen Verwerfungen einmal in einem Musiktheaterstück exemplarisch darzustellen. Erste Anregungen gab das Gastspiel der französischen Theatergruppe „Mie de pain“ Mitte der 80er-Jahre in Freiburg im Breisgau: dort wurde ein merkwürdiges Blockflötenorchester dargestellt, dessen durch und durch korrupte und intrigante Mitglieder keine Gemeinheit auslassen und schließlich den Dirigenten umbringen. Dann die Begegnung mit Karl Valentins „Orchesterprobe“: jegliche musikalische Bemühung scheitert am faulen und desinteressierten Trompeter, der es fertig bringt, während der ganzen Szene nicht einen einzigen Ton zu spielen. Und schließlich der berühmte Film von Federico Fellini: das Orchester als Modell für die politische und soziale Gemeinschaft und ihre Verwandlung im Lauf der Geschichte.
All diese „Patenideen“ haben lange im Hintergrund gearbeitet und gedrängt – und nun ist tatsächlich ein Stück draus geworden. Allerdings hätte es so das Licht der Bühnenwelt nie erblickt ohne die kongeniale Mitwirkung der Autorin Verena Joos, die die Szenerie in einem abgehalfterten Theaterbetrieb angesiedelt und den Darstellern die Texte auf den Leib geschrieben hat, sowie des Grafikers und Fotografen Thomas Huther, des Lichtdesigners Michael Koch und der Kostümbildnerin Sonja Huther. Ihnen und allen unseren Darstellern herzlichen Dank für die hingebungsvolle Geburtshilfe!
Kassel, im August 2005
Reinhard KargerPRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 12. September 2005Weil auch Töne lügen können"Die Orchesterprobe" von Verena Joos und Reinhard Karger im GloriaVon Dirk Schwarze
Ist das nicht alles Theater, was wir auf der Bühne sehen? Tun sich nicht hinter dem perfekten Zusammenspiel und der viel beschworenen Harmonie Abgründe auf? Das mag wohl sein. Jedenfalls stellen Verena Joos (Text) und Reinhard Karger (Musik und Regie) in ihrer neuen Revue „Orchesterprobe“ uns einen verlorenen Haufen von Musikern vor, die Harmonien erzeugen wollen, in Wahrheit aber untereinander Krieg führen. Das Premierenpublikum im fast voll besetzten Gloria ließ sich gut unterhalten und spendete begeistert Beifall.Verena Joos (Text) und Reinhard Karger (Musik) sind ein erprobtes Gespann. In der Verbindung von Sprechtheater und Musik haben sie für sich die Revue als Gestaltungsform entdeckt und mit zwei Produktionen („Ich will keine Schokolade“, „Schluss mit Lustig“) auf diesem Feld schon Erfolge eingeheimst. Ihre neue Produktion fügt der Selbstbespiegelung des Theaters durch den Blick auf das Probenspiel eine unterhaltsame Variante hinzu. Dabei ist der Anlass, aus dem sich die Geschichte entwickelt, erschreckend und bedrohlich: Ein Theater wurde geschlossen. Übrig geblieben ist ein siebenköpfiges Orchester, das noch ein Recht und die Pflicht zu Aufführungen hat. Aber weil die Lage so aussichtslos ist, wird die Musik, die an die Klänge eines Kurorchesters erinnert, von Trauer und Melancholie durchzogen.Immer wieder wird die Generalprobe unterbrochen, weil sich die Musiker gegenseitig nerven, weil sie einmal ihre Verzweiflung und Wut herausschreien müssen und weil sie in faszinierenden Soli zeigen können, dass sie auch ganz anderer Leistungen fähig sind. So entpuppt sich das Zusammenspiel als große Selbsttäuschung. Selbst die Hoffnung, dass ,Töne nicht lügen können, erweist sich als Illusion.Joos und Karger gelingt es, aus dem traurigen Szenarium eine Groteske zu machen, die wesentlich von der Musik getragen wird. Allerdings überfordert die Länge der über 100-minütigen Produktion den Text. Die Geschichte würde von einer deutlichen Verdichtung profitieren.Dass der Abend zu einer kurzweiligen Unterhaltung wurde, ist der Tatsache zu verdanken, dass Joos und Karger um sich ein hervorragendes Team versammelten. Die Musiker entfalteten sich als überzeugende Schauspieler, die eindringlich kauzige Charaktere vorführten.Unbestrittener Star war Hugo Scholz als penetrant belehrender Alban (Saxofon), dessen gepresste Redeweise unvergesslich bleibt. Aber auch Regine von Lühmann (Kontrabass), Maria Weber-Krüger (Geige), Jürgen Sprenger (Trompete), Kathrin Vogler (Akkordeon), Stefan Hülsermann (Klarinette) und Michael Knauff (E-Gitarre) setzten nicht nur musikalisch Glanzlichter, sondern gefielen auch als eine Ansammlung von Sonderlingen. Dass die Probe immer wieder in die Gänge kam, dafür sorgte Andrea Gloggner als Mädchen für alles. Ihr ganz persönliches und erotisches Verhältnis zu den Musikinstrumenten hatte den Boden für die Revue bereitet.


Musiktheater
Die Orchesterprobe
Musiktheater von
Verena Joos und Reinhard Karger
2004/2005Die Orchesterprobe - Genese einer IdeeIch habe lange Jahre meines Arbeitslebens in Theatern verbracht, und von Anfang an hat mich besonders der Orchesterapparat fasziniert, nicht nur als Generator schöner und furchterregender Klänge, sondern auch als geschützter Lebensraum, in dem sich Menschen und Schwingungen auf einzigartige Weise begegnen. Wie ist es möglich, dass ein schlecht gelaunter Fagottist, der eben noch in der Kantine die übelsten Zoten gerissen hat, zehn Minuten später durch sein Spiel den edelsten Gefühlen Gestalt verleiht und das Publikum zu Tränen rührt? Was ist das für eine seltsame Gesellschaft, in der sich die verschiedenen Individuen und Interessengruppen genau wie im „richtigen Leben“ gegenseitig bekämpfen, und die doch übereinkommt, sich so zu disziplinieren, dass eine Botschaft über die Rampe oder aus dem Graben kommt, die alle Widersprüche aufhebt?
Früh wurde die Idee geboren, diesen modellhaften Kosmos mit all seinen grotesken und poetischen Verwerfungen einmal in einem Musiktheaterstück exemplarisch darzustellen. Erste Anregungen gab das Gastspiel der französischen Theatergruppe „Mie de pain“ Mitte der 80er-Jahre in Freiburg im Breisgau: dort wurde ein merkwürdiges Blockflötenorchester dargestellt, dessen durch und durch korrupte und intrigante Mitglieder keine Gemeinheit auslassen und schließlich den Dirigenten umbringen. Dann die Begegnung mit Karl Valentins „Orchesterprobe“: jegliche musikalische Bemühung scheitert am faulen und desinteressierten Trompeter, der es fertig bringt, während der ganzen Szene nicht einen einzigen Ton zu spielen. Und schließlich der berühmte Film von Federico Fellini: das Orchester als Modell für die politische und soziale Gemeinschaft und ihre Verwandlung im Lauf der Geschichte.
All diese „Patenideen“ haben lange im Hintergrund gearbeitet und gedrängt – und nun ist tatsächlich ein Stück draus geworden. Allerdings hätte es so das Licht der Bühnenwelt nie erblickt ohne die kongeniale Mitwirkung der Autorin Verena Joos, die die Szenerie in einem abgehalfterten Theaterbetrieb angesiedelt und den Darstellern die Texte auf den Leib geschrieben hat, sowie des Grafikers und Fotografen Thomas Huther, des Lichtdesigners Michael Koch und der Kostümbildnerin Sonja Huther. Ihnen und allen unseren Darstellern herzlichen Dank für die hingebungsvolle Geburtshilfe!
Kassel, im August 2005
Reinhard KargerPRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 12. September 2005Weil auch Töne lügen können"Die Orchesterprobe" von Verena Joos und Reinhard Karger im GloriaVon Dirk Schwarze
Ist das nicht alles Theater, was wir auf der Bühne sehen? Tun sich nicht hinter dem perfekten Zusammenspiel und der viel beschworenen Harmonie Abgründe auf? Das mag wohl sein. Jedenfalls stellen Verena Joos (Text) und Reinhard Karger (Musik und Regie) in ihrer neuen Revue „Orchesterprobe“ uns einen verlorenen Haufen von Musikern vor, die Harmonien erzeugen wollen, in Wahrheit aber untereinander Krieg führen. Das Premierenpublikum im fast voll besetzten Gloria ließ sich gut unterhalten und spendete begeistert Beifall.Verena Joos (Text) und Reinhard Karger (Musik) sind ein erprobtes Gespann. In der Verbindung von Sprechtheater und Musik haben sie für sich die Revue als Gestaltungsform entdeckt und mit zwei Produktionen („Ich will keine Schokolade“, „Schluss mit Lustig“) auf diesem Feld schon Erfolge eingeheimst. Ihre neue Produktion fügt der Selbstbespiegelung des Theaters durch den Blick auf das Probenspiel eine unterhaltsame Variante hinzu. Dabei ist der Anlass, aus dem sich die Geschichte entwickelt, erschreckend und bedrohlich: Ein Theater wurde geschlossen. Übrig geblieben ist ein siebenköpfiges Orchester, das noch ein Recht und die Pflicht zu Aufführungen hat. Aber weil die Lage so aussichtslos ist, wird die Musik, die an die Klänge eines Kurorchesters erinnert, von Trauer und Melancholie durchzogen.Immer wieder wird die Generalprobe unterbrochen, weil sich die Musiker gegenseitig nerven, weil sie einmal ihre Verzweiflung und Wut herausschreien müssen und weil sie in faszinierenden Soli zeigen können, dass sie auch ganz anderer Leistungen fähig sind. So entpuppt sich das Zusammenspiel als große Selbsttäuschung. Selbst die Hoffnung, dass ,Töne nicht lügen können, erweist sich als Illusion.Joos und Karger gelingt es, aus dem traurigen Szenarium eine Groteske zu machen, die wesentlich von der Musik getragen wird. Allerdings überfordert die Länge der über 100-minütigen Produktion den Text. Die Geschichte würde von einer deutlichen Verdichtung profitieren.Dass der Abend zu einer kurzweiligen Unterhaltung wurde, ist der Tatsache zu verdanken, dass Joos und Karger um sich ein hervorragendes Team versammelten. Die Musiker entfalteten sich als überzeugende Schauspieler, die eindringlich kauzige Charaktere vorführten.Unbestrittener Star war Hugo Scholz als penetrant belehrender Alban (Saxofon), dessen gepresste Redeweise unvergesslich bleibt. Aber auch Regine von Lühmann (Kontrabass), Maria Weber-Krüger (Geige), Jürgen Sprenger (Trompete), Kathrin Vogler (Akkordeon), Stefan Hülsermann (Klarinette) und Michael Knauff (E-Gitarre) setzten nicht nur musikalisch Glanzlichter, sondern gefielen auch als eine Ansammlung von Sonderlingen. Dass die Probe immer wieder in die Gänge kam, dafür sorgte Andrea Gloggner als Mädchen für alles. Ihr ganz persönliches und erotisches Verhältnis zu den Musikinstrumenten hatte den Boden für die Revue bereitet.


free musical projects
adorno
ein KonzertMichaela EhingerStimme
Marcel DaemgenElektronik
Reinhard KargerStimme
Christoph KornGitarre
Wolfgang Stryi_Bassklarinette/SaxophonFrankfurt/Main 2003
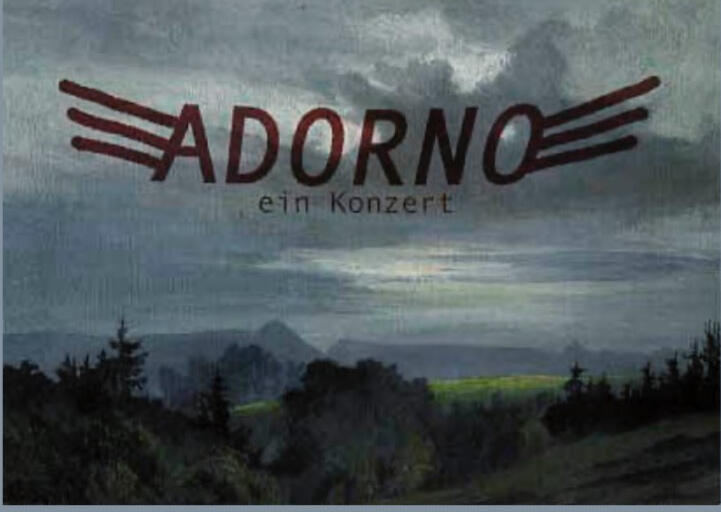
PRESSEFrankfurter Rundschau, 15.Dezember 2003Zärtlicher Adorno
Ein überraschend privates Konzert im Frankfurter Mousonturmvon Tim GorbauchEin bisschen Rauch liegt über der Bühne, der sich allmählich verflüchtigt. Drei, vier Bücher liegen verstreut auf der Bühne, ein Band der Gesammelten Schriften unter anderem, auch der Briefwechsel mit Thomas Mann, und deuten Privatheit an. Michaela Ehinger wird es sich später neben ihnen gemütlich machen, sich auf den Rücken legen, die Beine verschränken und daraus laut, aber doch fast mehr für sich vorlesen: "Wer denkt, ist in aller Kritik nicht wütend. Denken hat die Wut sublimiert. Weil der Denkende es sich nicht antun muss, will er es auch den anderen nicht antun. Das Glück, das im Auge des Denkenden aufgeht, ist das Glück der Menschheit."Über Resignation heißt der Vortrag, aus dem Ehinger da zitiert. Gehalten hat ihn Adorno im Februar 1969, als er die Definitionsmacht über die Linke längst verloren hatte und Studenten die sublimierte Wut öffentlich verhöhnten. Mit trotziger Melancholie hielt ihnen Adorno sein Weltbild entgegen, das die Straße als Ort des Protests und des Widerstands nicht kannte. Im Elfenbeinturm des Denkens war Adorno Zuhause. Nicht weil er Veränderung nicht wollte, sondern weil er die Macht der Theorie höher einschätzte als die der Praxis.Privat bleibt auch "Adorno. Ein Konzert" von der um Wolfgang Stryi und Reinhard Karger erweiterten Künstlergruppe TEXTxtnd. Oft wird es still im Frankfurter Künstlerhaus Mousonturm, manchmal strahlt die Bühne sogar in warmem Rot. Die zärtliche, von Sympathie getragene Melancholie, mit der das Quintett Adorno musikalisiert, ist auch deshalb so überraschend, weil Christoph Korn und Marcel Daemgen als musikalisches Zentrum von TEXTxtnd das Brachiale sonst nicht scheuen. Zwar ist die klangliche Forcierung, von der noch das im vergangenen Jahr uraufgeführte Marx-Projekt gekennzeichnet war, in Abschnitten noch spürbar, tritt aber doch entscheidend in den Hintergrund.Schon der Beginn führt gleichsam auf die Urgründe der Menschheit. Ein endlos tiefes Pochen der Elektronik (Marcel Daemgen), dazu ein paar vereinzelt in den Raum geworfene Gitarrenakkorde Christoph Korns und die kaum benennbare, eher an menschliche Laute als an Töne erinnernde Arbeit Wolfgang Stryis an der Kontrabassklarinette grundieren das Stück.
Die Musikalisierung Adornos bleibt auch danach abseits gängiger Genrezuordnungen, öffnet sich manchmal dem Minimal House, spielt mit zum Teil von Adorno selbst, zum Teil von Ehinger und Karger vorgetragenen Textfetzen wie mit Loops und Samples, während Korn mit verzerrter, agitierter Stimme immer wieder eine imaginäre Sitzordnung vorstellt.
Dort sitzt Immanuel Kant neben Matthias Beltz und Alfred 23 Harth zwischen Augustinus und Thomas von Aquin. Wenn das mal gut geht ...
freie Musikprojekte
adorno
ein KonzertMichaela EhingerStimme
Marcel DaemgenElektronik
Reinhard KargerStimme
Christoph KornGitarre
Wolfgang Stryi_Bassklarinette/SaxophonFrankfurt/Main 2003
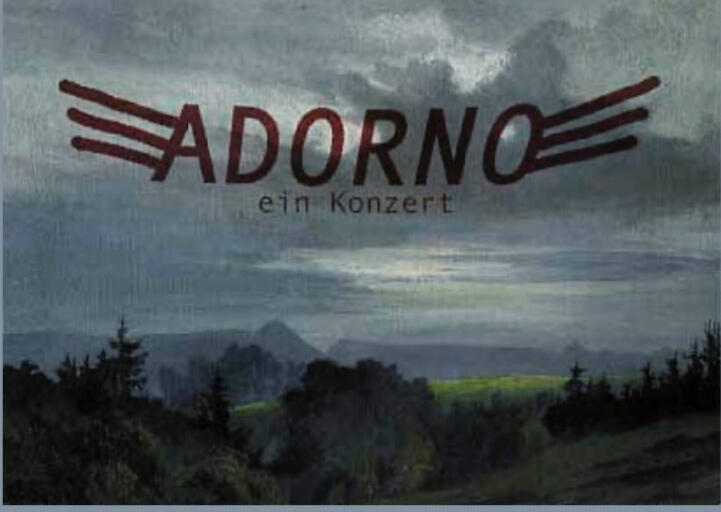
PRESSEFrankfurter Rundschau, 15.Dezember 2003Zärtlicher Adorno
Ein überraschend privates Konzert im Frankfurter Mousonturmvon Tim GorbauchEin bisschen Rauch liegt über der Bühne, der sich allmählich verflüchtigt. Drei, vier Bücher liegen verstreut auf der Bühne, ein Band der Gesammelten Schriften unter anderem, auch der Briefwechsel mit Thomas Mann, und deuten Privatheit an. Michaela Ehinger wird es sich später neben ihnen gemütlich machen, sich auf den Rücken legen, die Beine verschränken und daraus laut, aber doch fast mehr für sich vorlesen: "Wer denkt, ist in aller Kritik nicht wütend. Denken hat die Wut sublimiert. Weil der Denkende es sich nicht antun muss, will er es auch den anderen nicht antun. Das Glück, das im Auge des Denkenden aufgeht, ist das Glück der Menschheit."Über Resignation heißt der Vortrag, aus dem Ehinger da zitiert. Gehalten hat ihn Adorno im Februar 1969, als er die Definitionsmacht über die Linke längst verloren hatte und Studenten die sublimierte Wut öffentlich verhöhnten. Mit trotziger Melancholie hielt ihnen Adorno sein Weltbild entgegen, das die Straße als Ort des Protests und des Widerstands nicht kannte. Im Elfenbeinturm des Denkens war Adorno Zuhause. Nicht weil er Veränderung nicht wollte, sondern weil er die Macht der Theorie höher einschätzte als die der Praxis.Privat bleibt auch "Adorno. Ein Konzert" von der um Wolfgang Stryi und Reinhard Karger erweiterten Künstlergruppe TEXTxtnd. Oft wird es still im Frankfurter Künstlerhaus Mousonturm, manchmal strahlt die Bühne sogar in warmem Rot. Die zärtliche, von Sympathie getragene Melancholie, mit der das Quintett Adorno musikalisiert, ist auch deshalb so überraschend, weil Christoph Korn und Marcel Daemgen als musikalisches Zentrum von TEXTxtnd das Brachiale sonst nicht scheuen. Zwar ist die klangliche Forcierung, von der noch das im vergangenen Jahr uraufgeführte Marx-Projekt gekennzeichnet war, in Abschnitten noch spürbar, tritt aber doch entscheidend in den Hintergrund.Schon der Beginn führt gleichsam auf die Urgründe der Menschheit. Ein endlos tiefes Pochen der Elektronik (Marcel Daemgen), dazu ein paar vereinzelt in den Raum geworfene Gitarrenakkorde Christoph Korns und die kaum benennbare, eher an menschliche Laute als an Töne erinnernde Arbeit Wolfgang Stryis an der Kontrabassklarinette grundieren das Stück.
Die Musikalisierung Adornos bleibt auch danach abseits gängiger Genrezuordnungen, öffnet sich manchmal dem Minimal House, spielt mit zum Teil von Adorno selbst, zum Teil von Ehinger und Karger vorgetragenen Textfetzen wie mit Loops und Samples, während Korn mit verzerrter, agitierter Stimme immer wieder eine imaginäre Sitzordnung vorstellt.
Dort sitzt Immanuel Kant neben Matthias Beltz und Alfred 23 Harth zwischen Augustinus und Thomas von Aquin. Wenn das mal gut geht ...
free musical projects
cosmic comix
Hör-Spiele zwischen Alltag und Galaxisfür Stimme und Trommelvon Olaf Pyras und Reinhard Karger
2002Die moderne Snare-Drum schleppt wie einen Schatten die übermächtige Aura ihrer Vorgängerin (der Marschtrommel) mit sich herum : die Trommel als Signalgeberin, als militärisches Disziplinierungsinstrument, als Metronom der soldatischen Bewegungsvorgänge. Durch vielfältige Präparation, elektrische Verstärkung und ungewöhnliche Spielweisen wird diese Aura aufgebrochen und umgewandelt - der Snare-Drum sind plötzlich liebliche, zarte Töne zu entlocken und ihre durch die Tradition zementierte Aura löst sich auf in einem neuen, reicheren Klangkosmos.Die menschliche Stimme, zweites Klangaggregat in cosmic comix, nimmt beiläufige, "banale" Alltagsäußerungen zum Ausgangspunkt und stellt sie in überraschende mikroskopische und makroskopische Zusammenhänge, getreu der berühmten "butterfly wing theory": wenn in China ein Schmetterling mit dem Flügel schlägt, ändert sich der Lauf der Welt.....Aus dem Ineinandergreifen dieser beiden Klangaggregate entstehen groteske und poetische Hör-Spiele - galaktische Fäden durch die Zeiten und Räume....
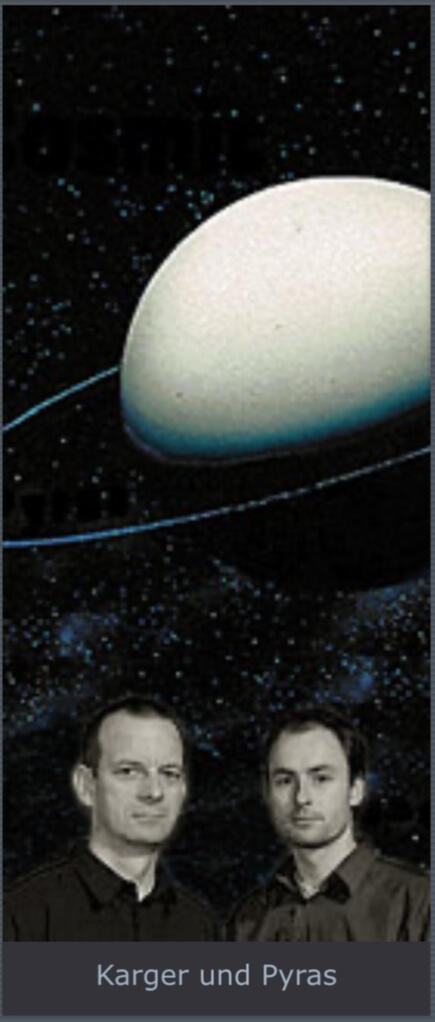
PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 24. April 2001Intellektuelle Klangreise
vom Endlichen bis ins UnendlicheReinhard Karger und Olaf Pyras boten im großen Bali
eine philosophische Klang-Performance mit Witz
Der Planet Uranus ist auf die Leinwand des großen Bali-Kinos projiziert. Ein Schlagzeuger und ein Stimmkünstler ergehen sich davor in allerlei ungewöhnlichen Klängen. Der eine streicht zum Beispiel mit einem Geigenbogen über einen Schneebesen, der auf einer Snare-Drum als Resonanzkörper liegt.Der andere pfeift, bläst Luft durch die Lippen, macht Plopp-Geräusche. Und wiederholt Sätze, die es in sich haben: Alles was existiert, existiert gerade dadurch, dass es durch seine Verhinderung existiert. Bei Cosmic Comix, dem neuen Projekt von Reinhard Karger (Stimme) und Olaf Pyras (Trommel), handelte es sich um ein intellektuell ansprechendes, oft witziges Spiel um die letzten Dinge.In einer straff organisierten Stunde zeigten die beiden in der Kasseler Neuen Musik-Szene prominenten Künstler, dass es oft nur ein kleiner Schritt vom Banalen in den Kosmos, vom Endlichen ins Unendliche ist. Bei einer Straßenbahnfahrt hat Karger das Gespräch aufgeschnappt: Bernd heißt er, aber wie weiter, oder Michael. Theologische Brisanz erhielt diese triviale Unsicherheit dadurch, dass Karger sie nach den zwölf Arten von Gottesbeweisen zitierte.Gut ausgedacht waren auch die musikalischen Aktionen, mit denen das Duo die Gedankenspiele widerspiegelte. Umstellung der Worte und Wiederholungen gaben den Alltagsäußerungen eine Wendung ins Artifizielle. Dass die Snare Drum gegen ihren herkömmlichen Charakter eingesetzt wurde, gehörte ebenfalls zum Thema Transzendierung des Gewöhnlichen.Durch leises Trommeln mit den Fingerspitzen entkleidete Pyras etwa einen Marsch-Rhythmus des martialischen Pomps. Einmal sorgte das Streichen auf simplen Aluminiumröhren für einen ätherischen Sound, der auch den letzten Romantiker für die Performance einnahm.Bleibt noch zu erwähnen, dass sich das Bali vorzüglich für solche grenzgängerischen Veranstaltungen eignet - wegen der guten Akustik und der Aura, mit der ein Kinosaal die Fantasie anregt. Es soll deshalb ab Juni für die von Reinhard Karger und Frank Thöner koordinierte Konzertreihe Soundcheck - neue Töne im Kulturbahnhof genutzt werden.Georg Pepl
freie Musikprojekte
cosmic comix
Hör-Spiele zwischen Alltag und Galaxisfür Stimme und Trommelvon Olaf Pyras und Reinhard Karger
2002Die moderne Snare-Drum schleppt wie einen Schatten die übermächtige Aura ihrer Vorgängerin (der Marschtrommel) mit sich herum : die Trommel als Signalgeberin, als militärisches Disziplinierungsinstrument, als Metronom der soldatischen Bewegungsvorgänge. Durch vielfältige Präparation, elektrische Verstärkung und ungewöhnliche Spielweisen wird diese Aura aufgebrochen und umgewandelt - der Snare-Drum sind plötzlich liebliche, zarte Töne zu entlocken und ihre durch die Tradition zementierte Aura löst sich auf in einem neuen, reicheren Klangkosmos.Die menschliche Stimme, zweites Klangaggregat in cosmic comix, nimmt beiläufige, "banale" Alltagsäußerungen zum Ausgangspunkt und stellt sie in überraschende mikroskopische und makroskopische Zusammenhänge, getreu der berühmten "butterfly wing theory": wenn in China ein Schmetterling mit dem Flügel schlägt, ändert sich der Lauf der Welt.....Aus dem Ineinandergreifen dieser beiden Klangaggregate entstehen groteske und poetische Hör-Spiele - galaktische Fäden durch die Zeiten und Räume....
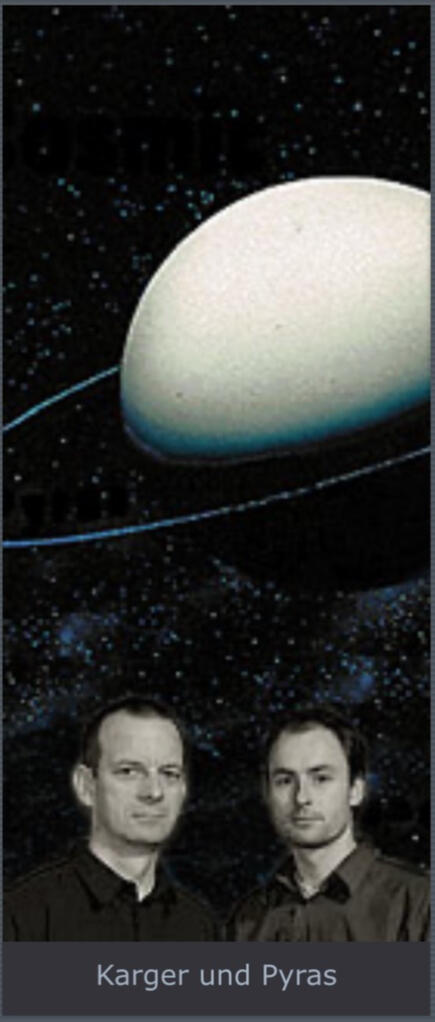
PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 24. April 2001Intellektuelle Klangreise
vom Endlichen bis ins UnendlicheReinhard Karger und Olaf Pyras boten im großen Bali
eine philosophische Klang-Performance mit Witz
Der Planet Uranus ist auf die Leinwand des großen Bali-Kinos projiziert. Ein Schlagzeuger und ein Stimmkünstler ergehen sich davor in allerlei ungewöhnlichen Klängen. Der eine streicht zum Beispiel mit einem Geigenbogen über einen Schneebesen, der auf einer Snare-Drum als Resonanzkörper liegt.Der andere pfeift, bläst Luft durch die Lippen, macht Plopp-Geräusche. Und wiederholt Sätze, die es in sich haben: Alles was existiert, existiert gerade dadurch, dass es durch seine Verhinderung existiert. Bei Cosmic Comix, dem neuen Projekt von Reinhard Karger (Stimme) und Olaf Pyras (Trommel), handelte es sich um ein intellektuell ansprechendes, oft witziges Spiel um die letzten Dinge.In einer straff organisierten Stunde zeigten die beiden in der Kasseler Neuen Musik-Szene prominenten Künstler, dass es oft nur ein kleiner Schritt vom Banalen in den Kosmos, vom Endlichen ins Unendliche ist. Bei einer Straßenbahnfahrt hat Karger das Gespräch aufgeschnappt: Bernd heißt er, aber wie weiter, oder Michael. Theologische Brisanz erhielt diese triviale Unsicherheit dadurch, dass Karger sie nach den zwölf Arten von Gottesbeweisen zitierte.Gut ausgedacht waren auch die musikalischen Aktionen, mit denen das Duo die Gedankenspiele widerspiegelte. Umstellung der Worte und Wiederholungen gaben den Alltagsäußerungen eine Wendung ins Artifizielle. Dass die Snare Drum gegen ihren herkömmlichen Charakter eingesetzt wurde, gehörte ebenfalls zum Thema Transzendierung des Gewöhnlichen.Durch leises Trommeln mit den Fingerspitzen entkleidete Pyras etwa einen Marsch-Rhythmus des martialischen Pomps. Einmal sorgte das Streichen auf simplen Aluminiumröhren für einen ätherischen Sound, der auch den letzten Romantiker für die Performance einnahm.Bleibt noch zu erwähnen, dass sich das Bali vorzüglich für solche grenzgängerischen Veranstaltungen eignet - wegen der guten Akustik und der Aura, mit der ein Kinosaal die Fantasie anregt. Es soll deshalb ab Juni für die von Reinhard Karger und Frank Thöner koordinierte Konzertreihe Soundcheck - neue Töne im Kulturbahnhof genutzt werden.Georg Pepl
free musical projects
SMS - short music stories
für Stimme, Altsaxophon und Baßklarinettevon Reinhard Karger und Wolfgang Stryi
2001HörprobeEin Höllenritt durch Sprache und Klang, ein Roulettespiel mit Fundstücken aus Musik und Literatur - unter freundlicher Mitwirkung heutiger Geister und historischer Paten (in der Reihenfolge ihres Auftretens): Johanna Joos, Chet Baker, Ernst Jandl, Marc Jongen, Archie Shepp, Charles Lewinsky, Olivier Messiaen, Giovanni Boccaccio, Janis Joplin und John Zorn.Es spielen Wolfgang Stryi (Altsaxophon und Baßklarinette) und Reinhard Karger (Stimme). Stryi ist Mitglied einer der international renommiertesten Gruppen für neue Musik, dem Frankfurter "Ensemble Modern".
PRESSEFrankfurter Rundschau 29. Juni 2002Die Kunst des ÜbergangsReinhard Karger & Wolfgang Stryi mit
"short music stories" in der Ensemble Akademie [Frankfurt/M.]Von Tim Gorbauch
Die Idee der short story als adäquate Erzählform der modernen Kunst ist nicht unbedingt neu. Auch Reinhard Karger und Wolfgang Stryi erheben in ihrem neuesten Projekt die Episode zum formalen Prinzip und arbeiten sich an Personen, Texten oder Stücken ab, die ihre Musikerlaufbahn entscheidend geprägt haben. Ihre short music stories, kurz sms, haben illustre und vielfältige Charaktere: Chet Baker ist dabei und Archie Shepp, Janis Joplin und John Zorn, Oliver Messiaen, Ernst Jandl und Marc Jongen. Karger und Stryi versprechen einen ,,Höllenritt durch Sprache und Klang, ein Roulettespiel mit Fundstücken aus Musik und Literatur".Das war natürlich etwas vollmundig, ein Höllenritt verheißt ein Spektakel, das Karger und Stryi gar nicht wollen. Und ein Roulettespiel ist aus diesem Konzert unterm Dach der Deutschen Ensemble Akademie in der Schwedlerstraße auch nicht geworden. An die Stelle von Zufall und Glücksspiel setzen beide einen enormen Konstruktionswillen, der auch gerade dann greifbar wird, wenn sich ihre gemeinsame Musik der Improvisation nähert. Der Wunsch nach Gestaltung und einer trotz aller spontanen Erfindung durch-artikulierten Musik äußert sich vor allem auch da, wo die Kurzgeschichte eigentlich schon zu Ende ist, in den Verknüpfungen, den Bindegliedern und Grauzonen zwischen den verarbeiteten Materialien. Die simple Variante wäre das Aneinanderkleben der einzelnen short stories, Karger und Stryi hingegen entscheiden sich für die Kunst des feinen Übergangs, blenden Themenfragmente allmählich ein, lassen sie nach und nach an Kontur gewinnen, bis sie Gestalt annehmen und eigene Kurzgeschichte werden.Karger gibt den short music stories seine Stimme, die er bis ins Geräuschhafte treibt und zugleich genug Gespür für den Humor und Hintersinn der Texte bereit hält. Stryi ist der gewohnt exzellente Klarinettist, ein Musiker von enormer Virtuosität und Unaufdringlichkeit zugleich, der den Ausschlägen, den Ein- und Ausbrüchen der Texte in jedem Augenblick folgen kann, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Das macht die Musik nicht nur besser, sondern zugleich auch enorm sympathisch.Hessische / Niedersächsische Allgemeine, 5. November 2001Allmählich wird Sprache zu Musik
Im Gießhaus führten Reinhard Karger (Stimme) und
Wolfgang Stryi (Bassklarinette und Altsaxofon) erstmals
ihr Sprachmusikprojekt "SMS", Short Music Stories, auf.Man kennt sich lange. Man kennt die gegenseitigen Vorlieben in Sachen Musik und Literatur. Manche Vorlieben des anderen teilt man, andere nimmt man interessiert zur Kenntnis. Und wenn man sich unterhält, dann genügt ein Stichwort, und der andere ist im Bilde. Auch Privates fließt natürlich ein. Reinhard Karger und Wolfgang Stryi führen so einen Dialog nicht nur als Gespräch, sie haben ihn strukturiert, improvisiert, komponiert. Das Ergebnis heißt SMS, Short Music Stories, und wurde jetzt im Gießhaus uraufgeführt.Der Titel verweist auf die minimalistische Handy-Kommunikation, doch in dem sprachmusikalischen Dialog, den Reinhard Karger (Stimme) und Wolfgang Stryi (Bassklarinette und Altsaxofon) führen, bleibt bei aller Knappheit genügend Raum für Spielerisches. Zehn Namen auf dem Programmzettel verweisen auf heutige Geister und historische Paten, die in dieser dialogischen Aktion eine Rolle spielen, und die Zuhörer sind bestrebt, Spuren der Genannten zu entdecken: Johanna Joos, Chet Baker, Ernst Jandl, Marc Jongen, Archie Shepp, Charles Lewinsky, Olivier Messiaen, Giovanni Boccaccio, Janis Joplin, John Zorn.In einigen Fällen geht das ganz leicht, anderes ist versteckter, flüchtiger. Aber auf die genaue Zuordnung kommt es weniger an. Viel interessanter ist, wie der Kasseler Komponist und der Bassklarinettist des Frankfurter Ensembles Modern mit ihrem Material umgehen.Karger beginnt mit einem eigenen Text. Zwei Situationen mit seiner Tochter Johanna. Einmal spielt eine Polizeikapelle, einmal Alfred Brendel eine Schubert-Klaviersonate. Der Text handelt von den Wahrnehmungen der Tochter. Karger spielt mit ihm, bricht die Wörter auf, behandelt die Silben wie Musikmotive und unterwirft sie Veränderungsprozessen.Allmählich wird Sprache zu Musik. Fast unmerklich gesellt sich die Bassklarinette dazu. Einzelne Töne mit Flatterzunge, überblasene Töne, bei denen der Grundton noch mitklingt. Immer konkreter werden die Motive, immer höher die Lage, und dann scheint das tiefe Holzblasinstrument sich für Momente in die gequetschte Trompete Chet Bakers zu verwandeln.Und so gehen die Episoden ineinander über. Neben den teils skurrilen Sprachspielen dominieren jazzige Töne. Manchmal entsteht eine Art Groove, vieles bleibt fragmentarisch. Das Repertoire an lautlichen Äußerungen, über das Karger mit Stimme und Atem und Stryi mit den beiden Instrumenten verfügen, ist so umfassend, wie es nur zwei Spezialisten für Neue Musik beherrschen.Und während im Wechsel mal Stimme, mal Instrument das Wort führt, kommt es gelegentlich zu Duett-Situationen, ganz ruhigen Momenten der Übereinstimmung in Sexten. Solche Ruhepunkte etwa auch, wenn das Altsaxofon Olivier Messiaen zitiert gehörten zu den intensivsten Momenten dieser musikalischen Kurzgeschichten, die so viel mehr waren als alles, was man sonst mit SMS assoziiert. Langer und herzlicher Beifall.Werner Fritsch

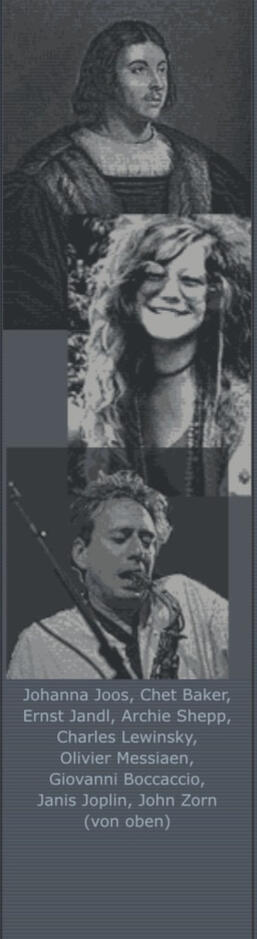
freie Musikprojekte
SMS - short music stories
für Stimme, Altsaxophon und Baßklarinettevon Reinhard Karger und Wolfgang Stryi
2001HörprobeEin Höllenritt durch Sprache und Klang, ein Roulettespiel mit Fundstücken aus Musik und Literatur - unter freundlicher Mitwirkung heutiger Geister und historischer Paten (in der Reihenfolge ihres Auftretens): Johanna Joos, Chet Baker, Ernst Jandl, Marc Jongen, Archie Shepp, Charles Lewinsky, Olivier Messiaen, Giovanni Boccaccio, Janis Joplin und John Zorn.Es spielen Wolfgang Stryi (Altsaxophon und Baßklarinette) und Reinhard Karger (Stimme). Stryi ist Mitglied einer der international renommiertesten Gruppen für neue Musik, dem Frankfurter "Ensemble Modern".
PRESSEFrankfurter Rundschau 29. Juni 2002Die Kunst des ÜbergangsReinhard Karger & Wolfgang Stryi mit
"short music stories" in der Ensemble Akademie [Frankfurt/M.]Von Tim Gorbauch
Die Idee der short story als adäquate Erzählform der modernen Kunst ist nicht unbedingt neu. Auch Reinhard Karger und Wolfgang Stryi erheben in ihrem neuesten Projekt die Episode zum formalen Prinzip und arbeiten sich an Personen, Texten oder Stücken ab, die ihre Musikerlaufbahn entscheidend geprägt haben. Ihre short music stories, kurz sms, haben illustre und vielfältige Charaktere: Chet Baker ist dabei und Archie Shepp, Janis Joplin und John Zorn, Oliver Messiaen, Ernst Jandl und Marc Jongen. Karger und Stryi versprechen einen ,,Höllenritt durch Sprache und Klang, ein Roulettespiel mit Fundstücken aus Musik und Literatur".Das war natürlich etwas vollmundig, ein Höllenritt verheißt ein Spektakel, das Karger und Stryi gar nicht wollen. Und ein Roulettespiel ist aus diesem Konzert unterm Dach der Deutschen Ensemble Akademie in der Schwedlerstraße auch nicht geworden. An die Stelle von Zufall und Glücksspiel setzen beide einen enormen Konstruktionswillen, der auch gerade dann greifbar wird, wenn sich ihre gemeinsame Musik der Improvisation nähert. Der Wunsch nach Gestaltung und einer trotz aller spontanen Erfindung durch-artikulierten Musik äußert sich vor allem auch da, wo die Kurzgeschichte eigentlich schon zu Ende ist, in den Verknüpfungen, den Bindegliedern und Grauzonen zwischen den verarbeiteten Materialien. Die simple Variante wäre das Aneinanderkleben der einzelnen short stories, Karger und Stryi hingegen entscheiden sich für die Kunst des feinen Übergangs, blenden Themenfragmente allmählich ein, lassen sie nach und nach an Kontur gewinnen, bis sie Gestalt annehmen und eigene Kurzgeschichte werden.Karger gibt den short music stories seine Stimme, die er bis ins Geräuschhafte treibt und zugleich genug Gespür für den Humor und Hintersinn der Texte bereit hält. Stryi ist der gewohnt exzellente Klarinettist, ein Musiker von enormer Virtuosität und Unaufdringlichkeit zugleich, der den Ausschlägen, den Ein- und Ausbrüchen der Texte in jedem Augenblick folgen kann, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Das macht die Musik nicht nur besser, sondern zugleich auch enorm sympathisch.Hessische / Niedersächsische Allgemeine, 5. November 2001Allmählich wird Sprache zu Musik
Im Gießhaus führten Reinhard Karger (Stimme) und
Wolfgang Stryi (Bassklarinette und Altsaxofon) erstmals
ihr Sprachmusikprojekt "SMS", Short Music Stories, auf.Man kennt sich lange. Man kennt die gegenseitigen Vorlieben in Sachen Musik und Literatur. Manche Vorlieben des anderen teilt man, andere nimmt man interessiert zur Kenntnis. Und wenn man sich unterhält, dann genügt ein Stichwort, und der andere ist im Bilde. Auch Privates fließt natürlich ein. Reinhard Karger und Wolfgang Stryi führen so einen Dialog nicht nur als Gespräch, sie haben ihn strukturiert, improvisiert, komponiert. Das Ergebnis heißt SMS, Short Music Stories, und wurde jetzt im Gießhaus uraufgeführt.Der Titel verweist auf die minimalistische Handy-Kommunikation, doch in dem sprachmusikalischen Dialog, den Reinhard Karger (Stimme) und Wolfgang Stryi (Bassklarinette und Altsaxofon) führen, bleibt bei aller Knappheit genügend Raum für Spielerisches. Zehn Namen auf dem Programmzettel verweisen auf heutige Geister und historische Paten, die in dieser dialogischen Aktion eine Rolle spielen, und die Zuhörer sind bestrebt, Spuren der Genannten zu entdecken: Johanna Joos, Chet Baker, Ernst Jandl, Marc Jongen, Archie Shepp, Charles Lewinsky, Olivier Messiaen, Giovanni Boccaccio, Janis Joplin, John Zorn.In einigen Fällen geht das ganz leicht, anderes ist versteckter, flüchtiger. Aber auf die genaue Zuordnung kommt es weniger an. Viel interessanter ist, wie der Kasseler Komponist und der Bassklarinettist des Frankfurter Ensembles Modern mit ihrem Material umgehen.Karger beginnt mit einem eigenen Text. Zwei Situationen mit seiner Tochter Johanna. Einmal spielt eine Polizeikapelle, einmal Alfred Brendel eine Schubert-Klaviersonate. Der Text handelt von den Wahrnehmungen der Tochter. Karger spielt mit ihm, bricht die Wörter auf, behandelt die Silben wie Musikmotive und unterwirft sie Veränderungsprozessen.Allmählich wird Sprache zu Musik. Fast unmerklich gesellt sich die Bassklarinette dazu. Einzelne Töne mit Flatterzunge, überblasene Töne, bei denen der Grundton noch mitklingt. Immer konkreter werden die Motive, immer höher die Lage, und dann scheint das tiefe Holzblasinstrument sich für Momente in die gequetschte Trompete Chet Bakers zu verwandeln.Und so gehen die Episoden ineinander über. Neben den teils skurrilen Sprachspielen dominieren jazzige Töne. Manchmal entsteht eine Art Groove, vieles bleibt fragmentarisch. Das Repertoire an lautlichen Äußerungen, über das Karger mit Stimme und Atem und Stryi mit den beiden Instrumenten verfügen, ist so umfassend, wie es nur zwei Spezialisten für Neue Musik beherrschen.Und während im Wechsel mal Stimme, mal Instrument das Wort führt, kommt es gelegentlich zu Duett-Situationen, ganz ruhigen Momenten der Übereinstimmung in Sexten. Solche Ruhepunkte etwa auch, wenn das Altsaxofon Olivier Messiaen zitiert gehörten zu den intensivsten Momenten dieser musikalischen Kurzgeschichten, die so viel mehr waren als alles, was man sonst mit SMS assoziiert. Langer und herzlicher Beifall.Werner Fritsch

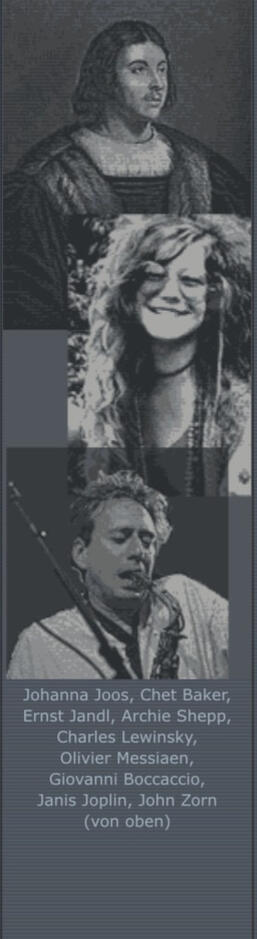
free musical projects
Seul, en train de ...
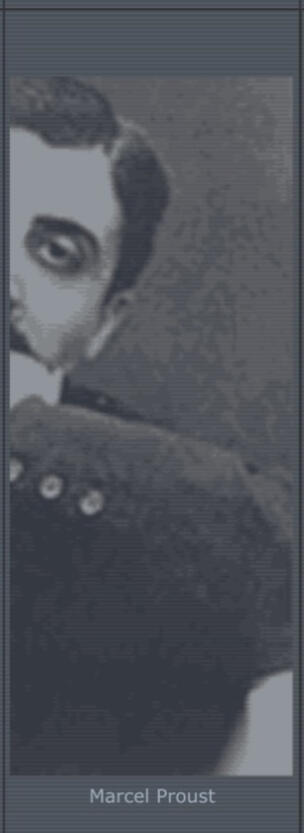
für Stimme und Kontrabaßklarinettenach einem Text von Marcel Proustvon Reinhard Karger und Wolfgang Stryi
1998/99HörprobeEin Reisender auf einer langen nächtlichen Zufahrt – er sitzt allein im Abteil, er ist müde und versinkt allmählich in einen eigentümlichen Dämmerzustand, eine Art Trance, wo die Grenzen von Tag und Traum sich verwischen ...
Karger und Stryi transformieren den Proust'schen Originaltext an die Grenze von Sprache und Musik, in einen Klangraum, in dem die klare Zeitgliederung unserer mitteleuropäischen Sprachtradition aufgelöst wird zugunsten eines Dämmerreiches von feinen und überraschenden musikalischen Nuancen, wo individuelle und objektive Zeit sich in jedem Augenblick neu definieren.Wolfgang Stryi ist Klarinettist und Saxophonist bei einer der international erfolgreichsten Gruppienrungen für neue Musik, dem Frankfurter "Ensemble Modem". Reinhard Karger lebt als Komponist, Musiker und Hochschullehrer in Kassel.
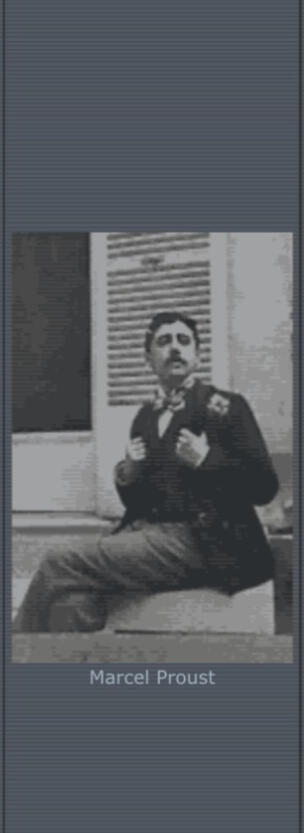
PRESSEFrankfurter Rundschau, 21. Dezember 1999Versuch über die gewonnene ZeitEin musikalisches Proust-Projekt von Reinhard Karger und Wolfgang Stryi im Hessischen Literaturbüro FrankfurtIm Künstlerhaus Mousonturm zu Frankfurt am Main befinden sich nicht nur zwei Bühnen für Darstellende Künste, sondern auch das Hessische Literaturbüro, in dessen Räumlichkeiten regelmäßige Lesungen und Veranstaltungen grenzüberschreitender Art durchgeführt werden.Diesmal war hier die Musik zu Gast, aber zweifellos eine literarisch eminent inspirierte – schon lange erlebte man nicht in dieser Intensität, in welchem Maß Schriftstellersprache auf musikalische Phantasie einzuwirken vermag und diese befruchtend anspornt. Es kam dabei zu einem Höhenflug der Synästhesie, wie er zum Jahresende nicht sinnlicher und besinnlicher sein könnte.Reinhard Karger und Wolfgang Stryi nehmen sich eines Textes von Marcel Proust an, in dem sich ein imaginärer Zeitreisender während einer nächtlichen Zugfahrt auf der Suche nach jener verlorenen vierten Dimension begibt. Stryi spielt Kontrabassklarinette – doch was heißt hier: spielt? Er haucht in den Korpus dieses ungeheuerlichen Instrumentes, setzt übergeblasene Flageoletta darüber und erzeugt damit – fast ohne Mittellagen – jenen urwüchsigen Odem, den man im Wind eines norwegischen Fjords genauso hört wie im Raunen und Rauschen einer Dampflokomotive.Der Reisende bei Proust verliert sich während dieser Zugfahrt; er nickt ein, und zwischen den verschiedenen Stadien des Dahindösens drückt ihm der Atem der Lok und der Räder seinen Stempel in die Assoziationen des Halbschlafs, in dem er ständig sich bewegt, so als sei der Zug ein stehendes Gehäuse, das sich dem Auftrieb des Sturmes entgegenstemmt.Karger spielt ein wunderbares Instrument: die menschliche Stimme. Meist haucht er, dann bündelt er Zischlaute, und stets findet er die kongeniale Entsprechung zu Stryis Instrument, dem er etwas entgegenzusetzen hat und mit dem er zu einer Einheit verschmilzt, so wie der anonyme Zeitreisende in der Textvorlage, der noch die Sechzehntelnoten aus der Vorgabe der Dampflokomotive, der Zeit, des Lebens heraushörte.Und diese Textvorlage ist sehr widerstandsfähig. Karger springt zwischen den Worten und lyrischen Bildern nach einem ausgeklügelten Prinzip. Er und Stryi sind Studienkollegen.Wolfgang Stryi muss man nicht mehr vorstellen, er ist einer der bedeutendsten Holzbläser Europas (welches Mitglied des Ensemble Modern könnte das nicht von sich sagen?), Reinhard Karger ist ein Studienkollege aus dem Fachbereich Komposition, und er komponiert hier in einer Mischung aus strikter Konzeption – indem er mit mathematischen Vorgaben ganz kalkuliert arbeitet und sich dann wieder mit der Bassklarinette trifft, ihren Hauch aufnimmt, ihn wieder zurückgibt und damit dem Text ein mächtiges Eigenleben einhaucht. Die Übersetzung hat Eva Rechel-Mertens besorgt, und ihre Stabungen der Zischlaute kommen dieser imaginären Eisenbahnfahrt sehr zugute, die von singender Stimme und schwingendem Holz in höchster Lautmalermeisterschaft umgesetzt werden.Die Frage, ob die "temps" am Ende dieses Jahrtausends "perdu" sind, erhebt sich nicht. Dargestellt wird hier ein ewiges "panta rhei" von Hauch und Harmonie, von Wort und Widerwort, das dieses zerrissene Millennium in einer lyrisch-musikalischen Sternstunde wohlig ausklingen lässt.
Michael RiethFrankfurter Rundschau, 4. April 2000(...) Wunderbar ausgehört, von ungeahnter Tiefenschärfe und in allen gestaltplastischen Graden gegenwärtig war die Klangbildung von Wolfgang Stryi (Kontrabassklarinette) und Reinhard Karger (Stimme) in ihrem gemeinsam geschaffenen Musikprojekt nach einem Text von Marcel Proust ... seul, en train de ... wobei es um die Zeiterfahrung während einer Nachtfahrt mit der Eisenbahn geht. Das Stück war nicht notiert und doch auf der Höhe kompositorischer Differenziertheit - solange und genau haben die beiden Musiker Ihren Versuch entwickelt.
Das Zittern und Surren, Rattern und Pulsieren des sich bewegenden und doch
als Kabine ruhenden Abteils mit all seinen traumatisch abschweifenden und
Grenzzonen des Vorbewussten erreichenden Konsequenzen war eine grandiose
Klangrecherche. Die beiden Musikprofis vollbrachten eine Leistung, die im Gegensatz zu den Benufsgrenzgängern im Kunstgewerbe einmal wirklich als Gratwanderung zu erkennen war: die subtilste Form, eine Dampflok in Gestalt der lungen- und lippennahen, inner- und außerkörperlichen Luftröhren zu einer Fahrt in die Vorhöfe des Unbewussten zu bewegen. (...)
Bernhard Uske
freie Musikprojekte
Seul, en train de ...
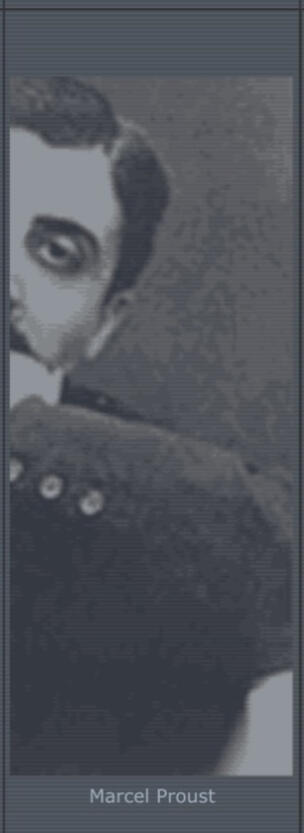
für Stimme und Kontrabaßklarinettenach einem Text von Marcel Proustvon Reinhard Karger und Wolfgang Stryi
1998/99HörprobeEin Reisender auf einer langen nächtlichen Zufahrt – er sitzt allein im Abteil, er ist müde und versinkt allmählich in einen eigentümlichen Dämmerzustand, eine Art Trance, wo die Grenzen von Tag und Traum sich verwischen ...
Karger und Stryi transformieren den Proust'schen Originaltext an die Grenze von Sprache und Musik, in einen Klangraum, in dem die klare Zeitgliederung unserer mitteleuropäischen Sprachtradition aufgelöst wird zugunsten eines Dämmerreiches von feinen und überraschenden musikalischen Nuancen, wo individuelle und objektive Zeit sich in jedem Augenblick neu definieren.Wolfgang Stryi ist Klarinettist und Saxophonist bei einer der international erfolgreichsten Gruppienrungen für neue Musik, dem Frankfurter "Ensemble Modem". Reinhard Karger lebt als Komponist, Musiker und Hochschullehrer in Kassel.
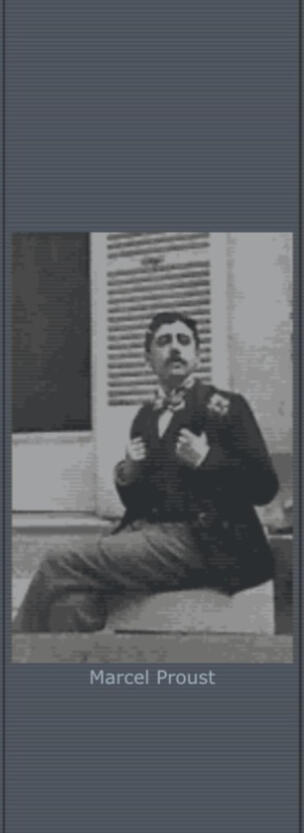
PRESSEFrankfurter Rundschau, 21. Dezember 1999Versuch über die gewonnene ZeitEin musikalisches Proust-Projekt von Reinhard Karger und Wolfgang Stryi im Hessischen Literaturbüro FrankfurtIm Künstlerhaus Mousonturm zu Frankfurt am Main befinden sich nicht nur zwei Bühnen für Darstellende Künste, sondern auch das Hessische Literaturbüro, in dessen Räumlichkeiten regelmäßige Lesungen und Veranstaltungen grenzüberschreitender Art durchgeführt werden.Diesmal war hier die Musik zu Gast, aber zweifellos eine literarisch eminent inspirierte – schon lange erlebte man nicht in dieser Intensität, in welchem Maß Schriftstellersprache auf musikalische Phantasie einzuwirken vermag und diese befruchtend anspornt. Es kam dabei zu einem Höhenflug der Synästhesie, wie er zum Jahresende nicht sinnlicher und besinnlicher sein könnte.Reinhard Karger und Wolfgang Stryi nehmen sich eines Textes von Marcel Proust an, in dem sich ein imaginärer Zeitreisender während einer nächtlichen Zugfahrt auf der Suche nach jener verlorenen vierten Dimension begibt. Stryi spielt Kontrabassklarinette – doch was heißt hier: spielt? Er haucht in den Korpus dieses ungeheuerlichen Instrumentes, setzt übergeblasene Flageoletta darüber und erzeugt damit – fast ohne Mittellagen – jenen urwüchsigen Odem, den man im Wind eines norwegischen Fjords genauso hört wie im Raunen und Rauschen einer Dampflokomotive.Der Reisende bei Proust verliert sich während dieser Zugfahrt; er nickt ein, und zwischen den verschiedenen Stadien des Dahindösens drückt ihm der Atem der Lok und der Räder seinen Stempel in die Assoziationen des Halbschlafs, in dem er ständig sich bewegt, so als sei der Zug ein stehendes Gehäuse, das sich dem Auftrieb des Sturmes entgegenstemmt.Karger spielt ein wunderbares Instrument: die menschliche Stimme. Meist haucht er, dann bündelt er Zischlaute, und stets findet er die kongeniale Entsprechung zu Stryis Instrument, dem er etwas entgegenzusetzen hat und mit dem er zu einer Einheit verschmilzt, so wie der anonyme Zeitreisende in der Textvorlage, der noch die Sechzehntelnoten aus der Vorgabe der Dampflokomotive, der Zeit, des Lebens heraushörte.Und diese Textvorlage ist sehr widerstandsfähig. Karger springt zwischen den Worten und lyrischen Bildern nach einem ausgeklügelten Prinzip. Er und Stryi sind Studienkollegen.Wolfgang Stryi muss man nicht mehr vorstellen, er ist einer der bedeutendsten Holzbläser Europas (welches Mitglied des Ensemble Modern könnte das nicht von sich sagen?), Reinhard Karger ist ein Studienkollege aus dem Fachbereich Komposition, und er komponiert hier in einer Mischung aus strikter Konzeption – indem er mit mathematischen Vorgaben ganz kalkuliert arbeitet und sich dann wieder mit der Bassklarinette trifft, ihren Hauch aufnimmt, ihn wieder zurückgibt und damit dem Text ein mächtiges Eigenleben einhaucht. Die Übersetzung hat Eva Rechel-Mertens besorgt, und ihre Stabungen der Zischlaute kommen dieser imaginären Eisenbahnfahrt sehr zugute, die von singender Stimme und schwingendem Holz in höchster Lautmalermeisterschaft umgesetzt werden.Die Frage, ob die "temps" am Ende dieses Jahrtausends "perdu" sind, erhebt sich nicht. Dargestellt wird hier ein ewiges "panta rhei" von Hauch und Harmonie, von Wort und Widerwort, das dieses zerrissene Millennium in einer lyrisch-musikalischen Sternstunde wohlig ausklingen lässt.
Michael RiethFrankfurter Rundschau, 4. April 2000(...) Wunderbar ausgehört, von ungeahnter Tiefenschärfe und in allen gestaltplastischen Graden gegenwärtig war die Klangbildung von Wolfgang Stryi (Kontrabassklarinette) und Reinhard Karger (Stimme) in ihrem gemeinsam geschaffenen Musikprojekt nach einem Text von Marcel Proust ... seul, en train de ... wobei es um die Zeiterfahrung während einer Nachtfahrt mit der Eisenbahn geht. Das Stück war nicht notiert und doch auf der Höhe kompositorischer Differenziertheit - solange und genau haben die beiden Musiker Ihren Versuch entwickelt.
Das Zittern und Surren, Rattern und Pulsieren des sich bewegenden und doch
als Kabine ruhenden Abteils mit all seinen traumatisch abschweifenden und
Grenzzonen des Vorbewussten erreichenden Konsequenzen war eine grandiose
Klangrecherche. Die beiden Musikprofis vollbrachten eine Leistung, die im Gegensatz zu den Benufsgrenzgängern im Kunstgewerbe einmal wirklich als Gratwanderung zu erkennen war: die subtilste Form, eine Dampflok in Gestalt der lungen- und lippennahen, inner- und außerkörperlichen Luftröhren zu einer Fahrt in die Vorhöfe des Unbewussten zu bewegen. (...)
Bernhard Uske
Theatre projects
music theatre

Ziehen Sie mich aus!
Eine Liebeserklärung an das französische Chanson
2018
für Stimme, Klavier und Kontrabass
Monologtexte: Verena Joos
Chansonübersetzungen und Regie: Reinhard Karger
Einspielung auf soundcloud.com hier
Seeblick
2016
theatre play with music
by Verena Joos and Reinhard Karger
directed by Reinhard Karger
silence here
2013
for 12 voices
based on a text by Samuel Beckett
compositions by students of the media composition class at the
University of Music and performing Arts Vienna
directed by Reinhard Karger
Quartett im Freien (quartet in the open air)
2011
theatre play with music
by Verena Joos and Reinhard Karger
Fermata
2010
for four voices and string quartet
libretto by Verena Joos
compositions by students of the media composition class at the
University of Music and performing Arts Vienna
directed by Reinhard Karger
Liebst Du mich? (do you love me?)
2008-09
musical theatre based on the book by Ronald D. Laing
for voices and instruments
also dann
2007-08
music theatre for two actors and piano duo
text by Verena Joos
re-composition by Reinhard Kargerfirst performance at Eclat-Festival 09 in Stuttgart
with Christina Weiser, Klaus Beyer and
the piano duo Grau/Schumacher
directed by Reinhard Karger
Malborough zieht in den Krieg
(Malborough at war)
2006-07
music theatre after Marcel Achard and Ernst Krenek
Teufelspakte (pacts with the devil)
or: five ways to sell your soul
2005-06
a musical-scenical collage,
developped by students of Universität Kassel
directed by Reinhard Karger
Die Orchesterprobe (the orchestra rehearsal)
2004-05
music theatre by Verena Joos and Reinhard Karger
Schluß mit lustig!
Eine Revue über die letzten Dinge
(a revue about the last things)
2003
by Verena Joos and Reinhard Karger
Ich will keine Schokolade (I don’t want no chocolate)
2002
a theatrical revue by Verena Joos and Reinhard Karger
Upstairs – downstairs
2001
music theatre with moving stairs
Remedia Amoris – ein Männerkonzert (a man’s concert)
1999-2000
music theatre for actors
Wüste Gegend. Stimmen. (waste land. voices)
1992-94
scene with timpani and trumpets
for 12 voices, 3 trumpets, 2 trombones, 3 impani
Fußgängerzone (pedestrians zone)
1990-91
music theatre
Beethovens Zukunft (Beethovens future)
1989
action for musician, grand piano and tape recorder
Words and Music
1985
(text by Samuel Beckett)
Vor der Vorstellung (before the performance)
1978
music theatre for violin, clarinet and tape
Theaterprojekte
Musiktheater
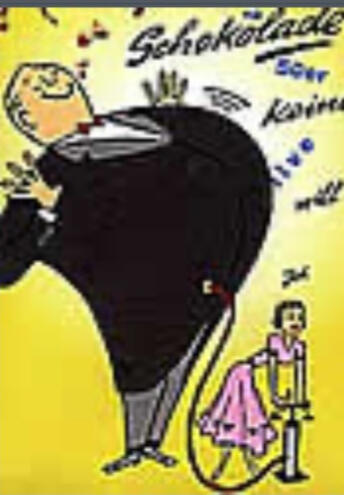
Ziehen Sie mich aus!
Eine Liebeserklärung an das französische Chanson
2018
für Stimme, Klavier und Kontrabass
Monologtexte: Verena Joos
Chansonübersetzungen und Regie: Reinhard Karger
Einspielung auf soundcloud.com hier
Seeblick
2016
Schauspiel mit Musik
von Verena Joos und Reinhard Karger
Regie: Reinhard Karger
silence here
2013
für 12 Stimmen
nach einem Text von Samuel Beckett
Kompositionen von Studierenden der Klasse Medienkomposition
an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Regie: Reinhard Karger
Quartett im Freien (quartet in the open air)
2011
Schauspiel mit Musik
von Verena Joos und Reinhard Karger
Fermata
2010
für Vokalquartett und Streichquartett
Libretto von Verena Joos
Kompositionen von Studierenden der Klasse Medienkomposition
an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Regie: Reinhard Karger
Liebst Du mich?
2008-09
Musiktheater nach Ronald D. Laing
für Stimmen und Instrumente
also dann
2007-08
Musiktheater für zwei Schauspieler und Klavierduo
Text von Verena Joos
Rekomposition von Reinhard Karger
UA beim Eclat-Festival 09 in Stuttgart
mit Christina Weiser, Klaus Beyer und
dem Klavierduo Grau/Schumacher,
Regie: Reinhard Karger
Malborough zieht in den Krieg
2006-07
Musiktheater nach Marcel Achard und Ernst Krenek
Teufelspakte oder: Fünf Arten, seine Seele zu verkaufen
2005-06
eine musikalisch-szenische Collage,
entwickelt und vorgestellt von Studierenden
der Fachrichtung Musik an der Universität Kassel
unter der Leitung von Prof. Reinhard Karger
Die Orchesterprobe (the orchestra rehearsal)
2004-05
Musiktheater von Verena Joos und Reinhard Karger
Schluß mit lustig!
Eine Revue über die letzten Dinge
2003
Eine Revue über die letzten Dinge
von Verena Joos und Reinhard Karger
Ich will keine Schokolade
2002
Eine Theaterrevue von Verena Joos und Reinhard Karger
Upstairs – downstairs
2001
Musiktheater mit Rolltreppen
Remedia Amoris – ein Männerkonzert
1999-2000
Musiktheater für Schauspiele
Wüste Gegend. Stimmen.
1992-94
Szene mit Pauken und Trompeten für 12 Stimmen, 3 Tr, 2 Pos, 3 Pk
Fußgängerzone (pedestrians zone)
1990-91
Musiktheater
Beethovens Zukunft
1989
Aktion für Musiker, Flügel und Kassettenrecorder
Words and Music
1985
(Text von Samuel Beckett)
Vor der Vorstellung
1978
Musiktheater für Violine, Klarinette und Tonband
Theatre projects
theatre music
Zwei Münchner in der Hölle (Valentin-Siefert) Bonn 2001
Prinzessin Brambilla (E.T.A. Hoffmann) Essen 2000
Die Riesen von Phoenix (Konserve) Kassel 1998
Götterfunken (für Salonorchester) Köln 1998
Scherz, Satire, Ironie ... (Grabbe) Essen 1997
Woyzeck Kassel 1996
Die Dreigroschenoper Bonn 1995
Peer Gynt (Ibsen) Kassel 1994
Soliman (Fels) Kassel 1994
Cyrano von Bergerac (Rostand) Münster 1993
Der indische Traum (Cixous) Bonn 1992
Lysistrata (Aristophanes) Kassel 1991
Die Mutter (Brecht/Eisler) Kassel 1990
Prinzessin Eselshaut (Siefert) Kassel 1990
Prinz Sihanouk (Cixous) Kassel 1988
Gefährliche Liebschaften (Laclos) Frankfurt 1987
Professor Unrat (Heinrich Mann/Siefert) Kassel 1987
König Lear (Shakespeare) Kassel 1986
Draußen vor der Tür (Borchert) Freiburg 1986
Baal (Brecht) Freiburg 1986
Ein Sommernachtstraum (Shakespeare) Kassel 1985-86
Oh Robinson (Hoffmann/Siefert) Kassel 1985
Wiener G'schichten (Qualtinger u.a.) Kassel 1985
Die Dreigroschenoper (Brecht/Weill) Kassel 1985
Dario Fo Spektakel Kassel 1985
Der eingebildet Kranke (Moliere) Freiburg 1985
Verdunklung (Enquist) Darmstadt 1984-85
Weihnachten an der Front (Savary) Kassel 1984
Märchen von einem, der auszog, (Copenhaver) Freiburg 1983
Das kurze Leben der Schneewolken (Bauer) Stuttgart 1983
Fegefeuer in Ingolstadt (Fleißer) Freiburg 1983
Starker Hans (Mennicken) Freiburg 1983
Der Talisman (Nestroy) Freiburg 1982
Die Dreigroschenoper (Brecht/Weill) Freiburg 1981
Die toten Seelen (Gogol/Siefert) Freiburg 1981
George Dandin (Moliere) Wiesbaden 1980
Krach in Chiozza (Goldoni) Wiesbaden 1979
Klein Zack (Hoffmann/Siefert) Freiburg 1979
Biedermann und die Brandstifter (Frisch) Los Angeles 1977
Die argentinische Nacht (Brasch) Tübingen 1977
Urfaust (Goethe) Stuttgart 1976
Der Zusammenstoß (Schwitters) Tübingen 1976
Theaterprojekte
theatre music
Zwei Münchner in der Hölle (Valentin-Siefert) Bonn 2001
Prinzessin Brambilla (E.T.A. Hoffmann) Essen 2000
Die Riesen von Phoenix (Konserve) Kassel 1998
Götterfunken (für Salonorchester) Köln 1998
Scherz, Satire, Ironie ... (Grabbe) Essen 1997
Woyzeck Kassel 1996
Die Dreigroschenoper Bonn 1995
Peer Gynt (Ibsen) Kassel 1994
Soliman (Fels) Kassel 1994
Cyrano von Bergerac (Rostand) Münster 1993
Der indische Traum (Cixous) Bonn 1992
Lysistrata (Aristophanes) Kassel 1991
Die Mutter (Brecht/Eisler) Kassel 1990
Prinzessin Eselshaut (Siefert) Kassel 1990
Prinz Sihanouk (Cixous) Kassel 1988
Gefährliche Liebschaften (Laclos) Frankfurt 1987
Professor Unrat (Heinrich Mann/Siefert) Kassel 1987
König Lear (Shakespeare) Kassel 1986
Draußen vor der Tür (Borchert) Freiburg 1986
Baal (Brecht) Freiburg 1986
Ein Sommernachtstraum (Shakespeare) Kassel 1985-86
Oh Robinson (Hoffmann/Siefert) Kassel 1985
Wiener G'schichten (Qualtinger u.a.) Kassel 1985
Die Dreigroschenoper (Brecht/Weill) Kassel 1985
Dario Fo Spektakel Kassel 1985
Der eingebildet Kranke (Moliere) Freiburg 1985
Verdunklung (Enquist) Darmstadt 1984-85
Weihnachten an der Front (Savary) Kassel 1984
Märchen von einem, der auszog, (Copenhaver) Freiburg 1983
Das kurze Leben der Schneewolken (Bauer) Stuttgart 1983
Fegefeuer in Ingolstadt (Fleißer) Freiburg 1983
Starker Hans (Mennicken) Freiburg 1983
Der Talisman (Nestroy) Freiburg 1982
Die Dreigroschenoper (Brecht/Weill) Freiburg 1981
Die toten Seelen (Gogol/Siefert) Freiburg 1981
George Dandin (Moliere) Wiesbaden 1980
Krach in Chiozza (Goldoni) Wiesbaden 1979
Klein Zack (Hoffmann/Siefert) Freiburg 1979
Biedermann und die Brandstifter (Frisch) Los Angeles 1977
Die argentinische Nacht (Brasch) Tübingen 1977
Urfaust (Goethe) Stuttgart 1976
Der Zusammenstoß (Schwitters) Tübingen 1976
Theatre projects
cabaret projects
Liebst Du mich? (do you love me?)
cabaret based on the book by Ronald D. Laing
(production with students of Uni Kassel)
Kassel 2009
Du armer Herr König, dein Reich ist nun aus ...
(poor king, your kingdom is gone)
musical cabaret about Jérome Bonaparte
Kassel 2007
O du lieber Augustin
Ein schwarzer Wiener Abend (a black Viennese evening)
(with Peter Anger, Hellmuth Vivell and Matthias Henke)
Kassel 2003
Wir sind dabei! (we are in!)
Original-Töne aus der frühen DDR
(original texts and sounds from the early GDR)
(production with students of Uni Kassel)
Kassel 2003
Jüngling, laß dich nicht gelüsten...
(songs by Frank Wedekind, production with students of Uni Kassel)
Kassel 2000
Lieder aus Theresienstadt (songs from Theresienstadt)
(with Peter Anger)
Kassel 1999
Der Tod des Märchenprinzen (death of a prince)
(with Hergard Engert and Verena Joos)
Kassel 1999
.. ich weiß nicht, zu wem ich gehöre ...
(to whom do I belong?)
(songs by Friedrich Hollaender,
production with students of Uni Kassel)Kassel 1999
Höchste Eisenbahn (with Verena Joos)
Los Angeles 1997
Zwar hat er viel von mir ... (Hahn, Joos)
Kassel 1995
Kompakt und Käuflich (Gieseking, Joos, Karger)
Kassel 1992
Eben lacht es, bumms da weint es ...
(Friedrich Hollaender)
Freiburg 1982
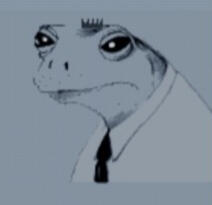
Theaterprojekte
Kabarett
Liebst Du mich?
Musikkabarett nach Ronald D. Laing
(Produktion mit Studierenden der Uni Kassel)
Kassel 2009
Du armer Herr König, dein Reich ist nun aus ...
Musikkabarett über Jérome Bonaparte
Kassel 2007
O du lieber Augustin
Ein schwarzer Wiener Abend
(mit Peter Anger, Hellmuth Vivell und Matthias Henke)
Kassel 2003
Wir sind dabei!
Original-Töne aus der frühen DDR
(Ein Programm der Fachrichtung Musik der Uni Kassel)
Kassel 2003
Jüngling, laß dich nicht gelüsten...
(Wedekind-Programm GhK)
Kassel 2000
Lieder aus Theresienstadt
(mit Peter Anger)
Kassel 1999
Der Tod des Märchenprinzen
(mit Hergard Engert und Verena Joos)
Kassel 1999
.. ich weiß nicht, zu wem ich gehöre ...
(Hollaender-Programm GhK)Kassel 1999
Höchste Eisenbahn (mit Verena Joos)
Los Angeles 1997
Zwar hat er viel von mir ... (Hahn, Joos)
Kassel 1995
Kompakt und Käuflich (Gieseking, Joos, Karger)
Kassel 1992
Eben lacht es, bumms da weint es ...
(Hollaender)
Freiburg 1982
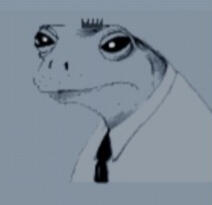
cabaret projects
Wir sind dabei!
Original-Töne aus der frühen DDRVon heute aus gesehen hat sich dieser deutsche Versuch von selbst erledigt, er erscheint — je nach Blickwinkel — entweder als nostalgische Erinnerung oder als linke Spinnerei: Der Versuch einen von Grund auf anderen, besseren deutschen Staat zu errichten, die Lehren aus der Katastrophe des dritten Reiches zu ziehen und in allen gesellschaftlichen Bereichen einen neuen, frischen, von Ideen der Gleichheit und Brüderlichkeit beflügelten Geist zu folgen.
Auf diese Zeit und diese utopische Kraft möchte das Kabarettprogramm "Wir sind dabei!" der Fachrichtung Musik an der Uni Kassel einen kritischen aber auch liebevollen Blick werfen, um dem damaligen Lebensgefühl auf die Spur zu kommen.
Auch wenn der Lauf der Geschichte über die DDR hinweggegangen ist — es lohnt sich, das Verlorengegangene noch einmal heraufzubeschwören.
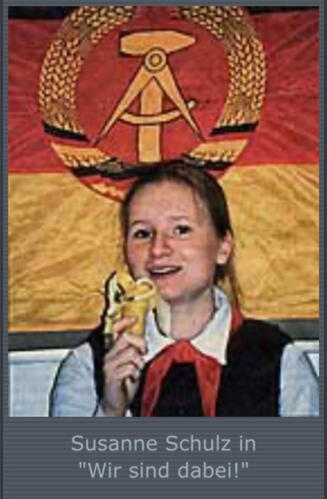
Kabarett
Wir sind dabei!
Original-Töne aus der frühen DDRVon heute aus gesehen hat sich dieser deutsche Versuch von selbst erledigt, er erscheint — je nach Blickwinkel — entweder als nostalgische Erinnerung oder als linke Spinnerei: Der Versuch einen von Grund auf anderen, besseren deutschen Staat zu errichten, die Lehren aus der Katastrophe des dritten Reiches zu ziehen und in allen gesellschaftlichen Bereichen einen neuen, frischen, von Ideen der Gleichheit und Brüderlichkeit beflügelten Geist zu folgen.
Auf diese Zeit und diese utopische Kraft möchte das Kabarettprogramm "Wir sind dabei!" der Fachrichtung Musik an der Uni Kassel einen kritischen aber auch liebevollen Blick werfen, um dem damaligen Lebensgefühl auf die Spur zu kommen.
Auch wenn der Lauf der Geschichte über die DDR hinweggegangen ist — es lohnt sich, das Verlorengegangene noch einmal heraufzubeschwören.

music theatre
„Ziehen Sie mich aus!“
2018Ein musikalisch-szenisches Projekt von und mit:
Verena Joos, Reinhard Karger, Udo Krüger, Traudl Schmaderer, Till SpohrDas französische Chanson der Fünfziger und Sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts, rotznasig-melancholisches Kind des Existenzialismus, hat in Deutschland kein Pendant. Die große Chansonniere Barbara hat es so charakterisiert: „Es ist sozial, satirisch, revolutionär, fröhlich, nostalgisch ... es führt jeden von uns an seine Wurzeln zurück.“
Sind diese „Wurzeln“ unabdingbar auf den Humus des französischen Idioms angewiesen? Oder können sie auch gedeihen, gar ihre Schönheit entfalten, wenn sie in den deutschen Sprachraum verpflanzt werden?
Der Komponist Reinhard Karger, seit seiner Jugend ein glühender Verehrer des französischen Chansons, hat dieses Wagnis erstmals 2016, für das Schauspiel „Seeblick“, auf sich genommen, indem er, für die Sängerin Traudl Schmaderer, drei Lieder von Barbara übersetzt hat. Unnötig zu sagen, dass „Übersetzung“ im metaphernreichen Genre des Chansons nicht bei der Wörtlichkeit stehen bleiben kann: Die dort verwendeten Sprachbilder verlieren beim Übertreten der Sprachgrenze ihre Gültigkeit und verlangen Findungen aus dem deutschen Metaphernkosmos. Die überaus positive Resonanz auf seine drei „Erstlinge“ hat ihn ermutigt, den reichen Fundus an Liedern jener Zeit weiter zu durchforsten. Er ist fündig geworden beim Oeuvre von Barbara, Jacques Brel, Juliette Gréco und Jeanne Moreau. 13 Chansons hat er ins Deutsche übertragen, die Traudl Schmaderer singen wird. Begleitet wird sie von Udo Krüger am Klavier - er hat auch die Arrangements besorgt - und Till Spohr am Kontrabass. Überleitende Monologe aus der Feder von Verena Joos werden, über einen reinen Liederabend hinaus, aus der Themenpalette zwischen Begehren und Resignation, Liebe und Hass, Wachheit und Trunksucht eine Art fiktionalen biographischen roten Faden spinnen. Denn: Die Frau, die da von ihrem reichen und doch beschädigten Leben singt, ist eine Kunstfigur. Eine Rolle, gewoben aus unterschiedlichen Facetten. Und es kann gut sein, dass das, was sie sagt, das Gegenteil meint von dem, was sie singt ...
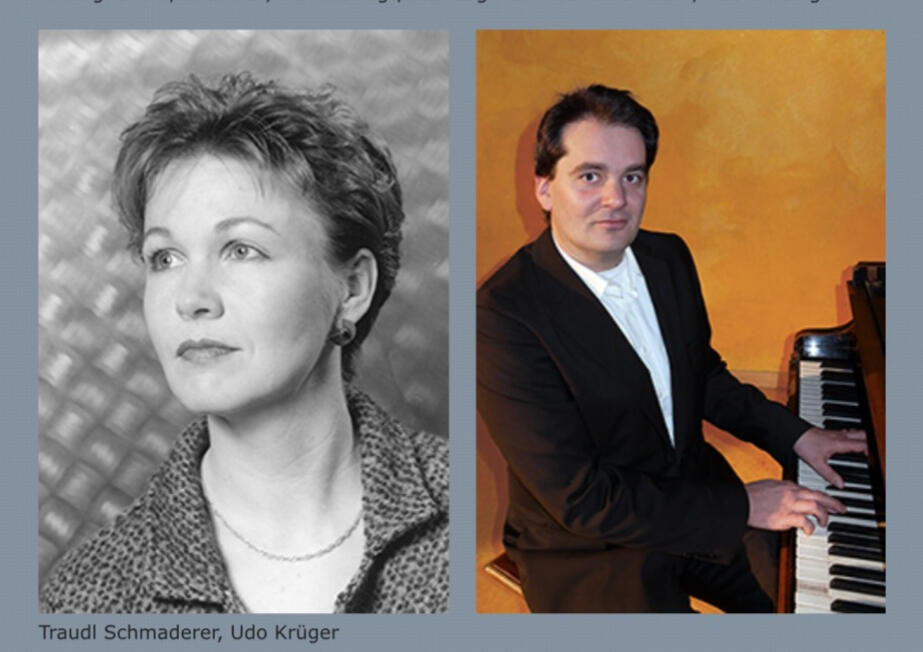

Theaterprojekte
„Ziehen Sie mich aus!“
2018Ein musikalisch-szenisches Projekt von und mit:
Verena Joos, Reinhard Karger, Udo Krüger, Traudl Schmaderer, Till SpohrDas französische Chanson der Fünfziger und Sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts, rotznasig-melancholisches Kind des Existenzialismus, hat in Deutschland kein Pendant. Die große Chansonniere Barbara hat es so charakterisiert: „Es ist sozial, satirisch, revolutionär, fröhlich, nostalgisch ... es führt jeden von uns an seine Wurzeln zurück.“
Sind diese „Wurzeln“ unabdingbar auf den Humus des französischen Idioms angewiesen? Oder können sie auch gedeihen, gar ihre Schönheit entfalten, wenn sie in den deutschen Sprachraum verpflanzt werden?
Der Komponist Reinhard Karger, seit seiner Jugend ein glühender Verehrer des französischen Chansons, hat dieses Wagnis erstmals 2016, für das Schauspiel „Seeblick“, auf sich genommen, indem er, für die Sängerin Traudl Schmaderer, drei Lieder von Barbara übersetzt hat. Unnötig zu sagen, dass „Übersetzung“ im metaphernreichen Genre des Chansons nicht bei der Wörtlichkeit stehen bleiben kann: Die dort verwendeten Sprachbilder verlieren beim Übertreten der Sprachgrenze ihre Gültigkeit und verlangen Findungen aus dem deutschen Metaphernkosmos. Die überaus positive Resonanz auf seine drei „Erstlinge“ hat ihn ermutigt, den reichen Fundus an Liedern jener Zeit weiter zu durchforsten. Er ist fündig geworden beim Oeuvre von Barbara, Jacques Brel, Juliette Gréco und Jeanne Moreau. 13 Chansons hat er ins Deutsche übertragen, die Traudl Schmaderer singen wird. Begleitet wird sie von Udo Krüger am Klavier - er hat auch die Arrangements besorgt - und Till Spohr am Kontrabass. Überleitende Monologe aus der Feder von Verena Joos werden, über einen reinen Liederabend hinaus, aus der Themenpalette zwischen Begehren und Resignation, Liebe und Hass, Wachheit und Trunksucht eine Art fiktionalen biographischen roten Faden spinnen. Denn: Die Frau, die da von ihrem reichen und doch beschädigten Leben singt, ist eine Kunstfigur. Eine Rolle, gewoben aus unterschiedlichen Facetten. Und es kann gut sein, dass das, was sie sagt, das Gegenteil meint von dem, was sie singt ...
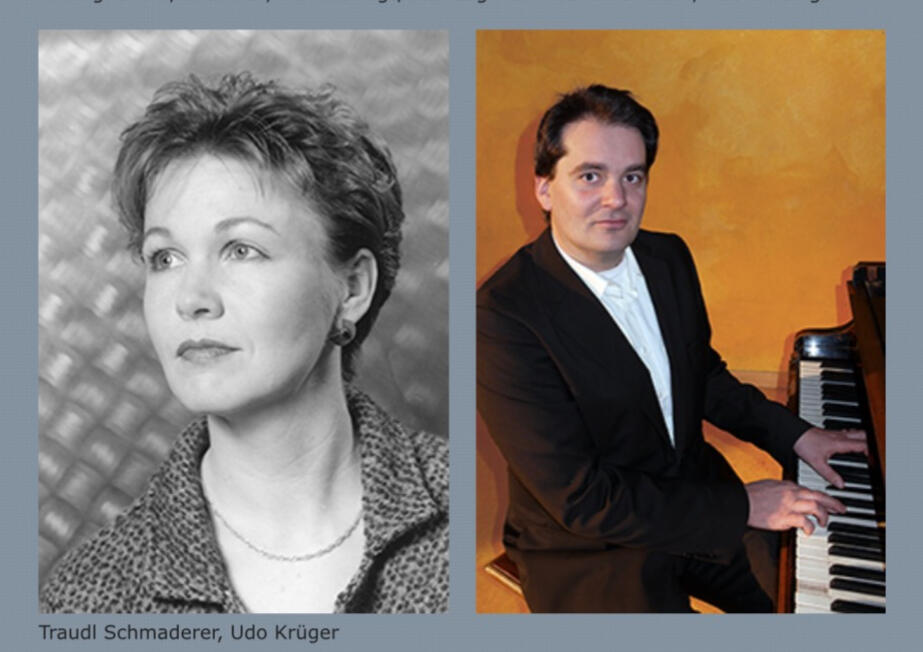
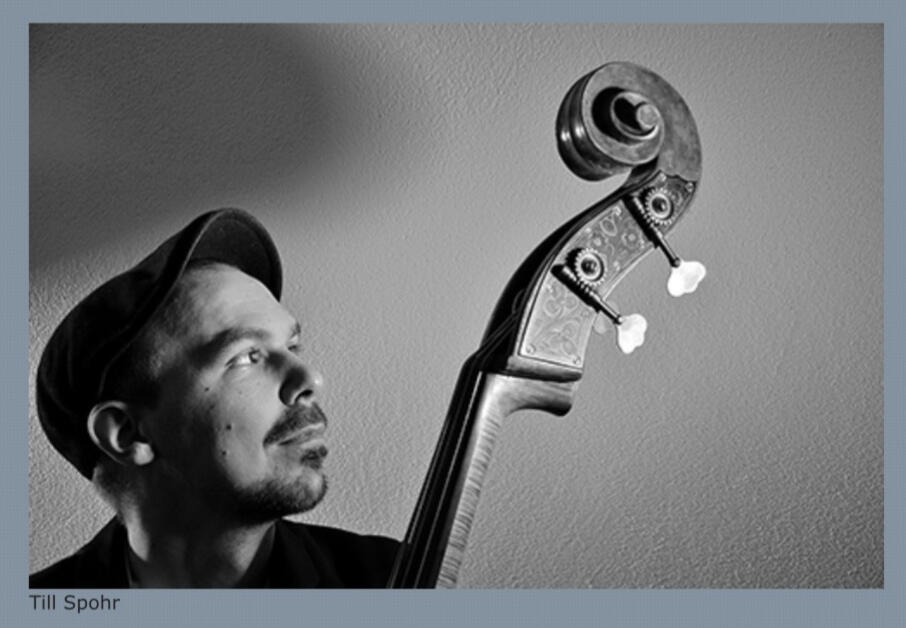
music theatre
Quartett im Freien
2008Schauspiel mit Musik von Verena Joos und Reinhard KargerVier Personen sitzen an einer Bushaltestelle in der Vorstadt und warten auf den Bus. Aber der Bus kommt nicht. Sie warten schon sehr lange, und keiner weiß so recht, wann der Bus eigentlich das letzte Mal gefahren ist, ob er überhaupt noch fährt oder in naher oder ferner Zukunft fahren wird – so dehnt sich die Zeit, und das Warten selbst wird zum zentralen Thema.
Wie Schiffbrüchige schwanken die vier Menschen zwischen Gereiztheit und dumpfer Ergebenheit; aus der ausweglosen Situation entstehen skurrile, schrill überdrehte, aber auch poetische Szenen und Dialoge. Und wenn das rechte Wort zur rechten Zeit sich partout nicht mehr einstellen will, dann übernimmt der Gesang - Töne und Akkorde klingen aus den Kehlen in den Raum, jeder singt für sich (und doch gemein-sam) sein eigenes Lied. Das musikalische Grundmaterial entstammt dem Fundus, der uns allen täglich in den Ohren klingelt: dem Reich der Klassik-Hits, der Jingles, Apps, Werbungen und Kaufhaus-Klangteppiche.


Theaterprojekte
Quartett im Freien
2008Schauspiel mit Musik von Verena Joos und Reinhard KargerVier Personen sitzen an einer Bushaltestelle in der Vorstadt und warten auf den Bus. Aber der Bus kommt nicht. Sie warten schon sehr lange, und keiner weiß so recht, wann der Bus eigentlich das letzte Mal gefahren ist, ob er überhaupt noch fährt oder in naher oder ferner Zukunft fahren wird – so dehnt sich die Zeit, und das Warten selbst wird zum zentralen Thema.
Wie Schiffbrüchige schwanken die vier Menschen zwischen Gereiztheit und dumpfer Ergebenheit; aus der ausweglosen Situation entstehen skurrile, schrill überdrehte, aber auch poetische Szenen und Dialoge. Und wenn das rechte Wort zur rechten Zeit sich partout nicht mehr einstellen will, dann übernimmt der Gesang - Töne und Akkorde klingen aus den Kehlen in den Raum, jeder singt für sich (und doch gemein-sam) sein eigenes Lied. Das musikalische Grundmaterial entstammt dem Fundus, der uns allen täglich in den Ohren klingelt: dem Reich der Klassik-Hits, der Jingles, Apps, Werbungen und Kaufhaus-Klangteppiche.


music theatre
also dann
2008Musiktheater für zwei Schauspieler und Klavierduo
Text von Verena Joos
Rekomposition von Reinhard Karger
UA beim Eclat-Festival 09 in Stuttgart
mit Christina Weiser,Klaus Beyer und dem Klavierduo Grau/Schumacher,
Regie: Reinhard KargerPRESSEFrankfurter Rundschau, 9. Februar 2009MusiktheaterUnverständnis auf allen SeitenVon Rainer NonnenmannIm Anfang waren Wort und Widerwort. Gleich zu Beginn der ersten Uraufführung des Stuttgarter Festivals Eclat prallten Welten aufeinander. Eine in mikrotonalen Intervallen langsam aufsteigende Klavierskala mündet plötzlich in das Kopfsatz-Allegro von Mozarts Klaviersonate a-Moll KV 310. Die Pianisten spielen auf zwei vierteltönig gegeneinander verstimmten Konzertflügeln. Fortgesetzter Dissens ist vorprogrammiert, denn strittig bleibt, wer hier gegen wen verstimmt ist.Unter ständigem Ringen um die "richtige" Intonation entwickelt sich das Geschehen zu penetrierter Disharmonie aus Sich-Fliehen, Sich-Suchen, Zuspielen und Gemeinsam-Spielen ohne wirklich zusammen kommen zu können.Hinter dem laxen Titel "Also dann" des Musiktheaterwerks von Verena Joos und Reinhard Karger verbirgt sich die Tragikomödie eines Paares, das sich auseinander gelebt hat und doch den letzten Schritt zur Trennung scheut. Weder sie noch er kann und will den anderen verlassen oder halten. Unter fortwährendem Hader bleiben Mann und Frau ineinander verkeilt.Wie zwei Panter umkreisen sich die Schauspieler Christina Weiser und Klaus Beyer im engen Lichtkegel eines Scheinwerfers. Sie kommen nicht voneinander los und liefern sich einen ebenso zermürbenden wie für das unbeteiligte Publikum belustigenden Rosenkrieg, mit wachsendem Unverständnis, zunehmender Frustration, verweigerter oder scheiternder Kommunikation.Im Wechsel mit den Leidensstationen des Paares spielt das Piano-Duo GrauSchumacher teils originale, teils dekomponierte und neu montierte Passagen aus Mozarts Klaviersonate. Dabei verwandeln sich Motive und Töne des einen Klaviers im veränderten mikrotonalen Kontext des anderen zu schmerzlich dissonierenden Fremdkörpern oder unerwiederten Klopfzeichen. Unverständnis auf allen Seiten.Gleichberechtigte KunstformenAutorin und Komponist wollten in ihrer "erotischen Versuchsanordnung" weder den Text mit Musik untermalen noch die Musik durch Inszenieren bebildern. Anstelle des alten Musenstreits - prima la parola oder prima la musica? - sollten sich beide Kunstformen mit gleichem Recht entfalten. So entstanden zwei Theaterstücke, ein szenisches, ein musikalisches, die sich durch den ständigen Wechsel erst nach und nach im Kopf des Hörer-Betrachters zum Gesamtereignis überlagern, indem er das Ehedrama unwillkürlich mit der Musik parallelisiert: mit den gegeneinander verstimmten Flügeln, dem Dualismus von "männlichem" und "weiblichem" Thema der Sonatenform und der Wiederkehr der Abschiedsformel "Also dann" zur einsetzenden Reprise - da capo, der Streit geht wieder von vorne los.Das Stuttgarter Festival für neue Musik Eclat hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Forum für experimentelles Musiktheater entwickelt. Es möchte Dinge ermöglichen, die der behäbige Apparat großer Stadt- und Staatstheater nicht zulässt, weil die hier zur Verfügung stehenden Räume, Kräfte, Sänger, Musiker und Werkstätten angemessen genutzt und beschäftigt werden wollen. (...)
Theaterprojekte
also dann
2008Musiktheater für zwei Schauspieler und Klavierduo
Text von Verena Joos
Rekomposition von Reinhard Karger
UA beim Eclat-Festival 09 in Stuttgart
mit Christina Weiser,Klaus Beyer und dem Klavierduo Grau/Schumacher,
Regie: Reinhard KargerPRESSEFrankfurter Rundschau, 9. Februar 2009MusiktheaterUnverständnis auf allen SeitenVon Rainer NonnenmannIm Anfang waren Wort und Widerwort. Gleich zu Beginn der ersten Uraufführung des Stuttgarter Festivals Eclat prallten Welten aufeinander. Eine in mikrotonalen Intervallen langsam aufsteigende Klavierskala mündet plötzlich in das Kopfsatz-Allegro von Mozarts Klaviersonate a-Moll KV 310. Die Pianisten spielen auf zwei vierteltönig gegeneinander verstimmten Konzertflügeln. Fortgesetzter Dissens ist vorprogrammiert, denn strittig bleibt, wer hier gegen wen verstimmt ist.Unter ständigem Ringen um die "richtige" Intonation entwickelt sich das Geschehen zu penetrierter Disharmonie aus Sich-Fliehen, Sich-Suchen, Zuspielen und Gemeinsam-Spielen ohne wirklich zusammen kommen zu können.Hinter dem laxen Titel "Also dann" des Musiktheaterwerks von Verena Joos und Reinhard Karger verbirgt sich die Tragikomödie eines Paares, das sich auseinander gelebt hat und doch den letzten Schritt zur Trennung scheut. Weder sie noch er kann und will den anderen verlassen oder halten. Unter fortwährendem Hader bleiben Mann und Frau ineinander verkeilt.Wie zwei Panter umkreisen sich die Schauspieler Christina Weiser und Klaus Beyer im engen Lichtkegel eines Scheinwerfers. Sie kommen nicht voneinander los und liefern sich einen ebenso zermürbenden wie für das unbeteiligte Publikum belustigenden Rosenkrieg, mit wachsendem Unverständnis, zunehmender Frustration, verweigerter oder scheiternder Kommunikation.Im Wechsel mit den Leidensstationen des Paares spielt das Piano-Duo GrauSchumacher teils originale, teils dekomponierte und neu montierte Passagen aus Mozarts Klaviersonate. Dabei verwandeln sich Motive und Töne des einen Klaviers im veränderten mikrotonalen Kontext des anderen zu schmerzlich dissonierenden Fremdkörpern oder unerwiederten Klopfzeichen. Unverständnis auf allen Seiten.Gleichberechtigte KunstformenAutorin und Komponist wollten in ihrer "erotischen Versuchsanordnung" weder den Text mit Musik untermalen noch die Musik durch Inszenieren bebildern. Anstelle des alten Musenstreits - prima la parola oder prima la musica? - sollten sich beide Kunstformen mit gleichem Recht entfalten. So entstanden zwei Theaterstücke, ein szenisches, ein musikalisches, die sich durch den ständigen Wechsel erst nach und nach im Kopf des Hörer-Betrachters zum Gesamtereignis überlagern, indem er das Ehedrama unwillkürlich mit der Musik parallelisiert: mit den gegeneinander verstimmten Flügeln, dem Dualismus von "männlichem" und "weiblichem" Thema der Sonatenform und der Wiederkehr der Abschiedsformel "Also dann" zur einsetzenden Reprise - da capo, der Streit geht wieder von vorne los.Das Stuttgarter Festival für neue Musik Eclat hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Forum für experimentelles Musiktheater entwickelt. Es möchte Dinge ermöglichen, die der behäbige Apparat großer Stadt- und Staatstheater nicht zulässt, weil die hier zur Verfügung stehenden Räume, Kräfte, Sänger, Musiker und Werkstätten angemessen genutzt und beschäftigt werden wollen. (...)
music theatre
Teufelspakte
oder:
Fünf Arten, seine Seele zu verkaufen
2005/2006eine musikalisch-szenische Collage,
entwickelt und vorgestellt von Studierenden
der Fachrichtung Musik an der Universität Kassel
unter der Leitung von Prof. Reinhard KargerPRESSEpublik, Juli 2006Teufelspakte, lustvoll präsentiertDie Konzertreihe "Soundcheck" startete mit fulminantem SpektakelDer Eulensaal ist nicht nur ein exzellenter Bibliotheks- und Vortragsraum, auch als Theatersaal weist er unbestreitbar hohe atmosphärische und akustische Qualitäten auf. Reinhard Karger, Professor der Fachrichtung Musik und als solcher zuständig für künstlerische Projekte, hat ihn, zur Premiere seiner Reihe "Soundcheck", zum Schauplatz gleich zweier theatralischer Spektakel gemacht. "Teufelspakte" hieß das erste, eine musikalisch-szenische Collage, entwickelt für und mit Studenten des Fachbereichs.
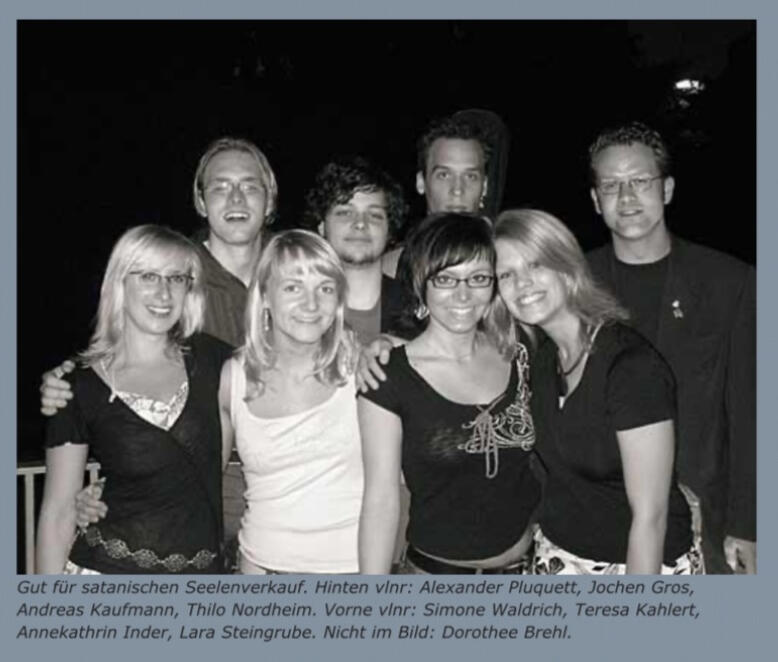
Alternierend zwischen virtuosem Solo und gekonnter chorischer Interaktion, präsentierte das neunköpfige Ensemble fünf satanische Varianten des Seelenverkaufs, von der barocken Ballade bis hin zur Ernst-Jandl-Adaption – ein teuflisches Kabinettstück, dessen Gelingen heftig bejubelt wurde. Eine Ouvertüre nach Maß, die vortrefflich auf den sechsten Teufelspakt einstimmte: "Die Geschichte vom Soldaten", Musiktheater von Charles F. Ramuz und Igor Strawinsky. Die Besetzung dieser prallen, Varietéatmosphäre ausstrahlenden, technisch allen Akteuren enorm viel abverlangende "Brettl-Oper" stellte, programmatisch für das Soundcheck-Konzept, eine gelungene Vernetzung diverser Gruppen dar. Im Orchester (Leitung: Andreas Cessak) mischten sich Lehrende der Fachrichtung Musik (Stefan Hülsermann, Klarinette; German Marstatt, Trompete; Olaf Pyras, Schlagzeug) mit Musikern aus dem Orchester des Staatstheaters zu einem beglückend homogenen Gesamtklang. Das Schauspielensemble (Regie: Reinhard Karger) setzte sich zusammen aus ehemaligen und aktuell Studierenden und einer professionellen Schauspielerin: Anja Haverland, welche den Part des Erzählers wohltuend mit rollenkompatibler Emotion auflud und so raffiniert den schneidigen "Ernst-Busch-Ton" vermied, der uns so oft von CD-Einspielungen entgegen quäkt. Susanne Schulz bezauberte als augenzwinkernd eitle Prinzessin, Timm Reitinger imponierte als leidend-kämpfender Soldat und Alexander Pluquett zeigte als teuflischer Irrwisch eine theatralisch wie akrobatisch gleichermaßen bewundernswerte Leistung. Ein dreimal trotz Fußballweltmeisterschaft prall gefüllter Saal bewies: Soundcheck hat sein Publikum gefunden.
Theaterprojekte
Teufelspakte
oder:
Fünf Arten, seine Seele zu verkaufen
2005/2006eine musikalisch-szenische Collage,
entwickelt und vorgestellt von Studierenden
der Fachrichtung Musik an der Universität Kassel
unter der Leitung von Prof. Reinhard KargerPRESSEpublik, Juli 2006Teufelspakte, lustvoll präsentiertDie Konzertreihe "Soundcheck" startete mit fulminantem SpektakelDer Eulensaal ist nicht nur ein exzellenter Bibliotheks- und Vortragsraum, auch als Theatersaal weist er unbestreitbar hohe atmosphärische und akustische Qualitäten auf. Reinhard Karger, Professor der Fachrichtung Musik und als solcher zuständig für künstlerische Projekte, hat ihn, zur Premiere seiner Reihe "Soundcheck", zum Schauplatz gleich zweier theatralischer Spektakel gemacht. "Teufelspakte" hieß das erste, eine musikalisch-szenische Collage, entwickelt für und mit Studenten des Fachbereichs.
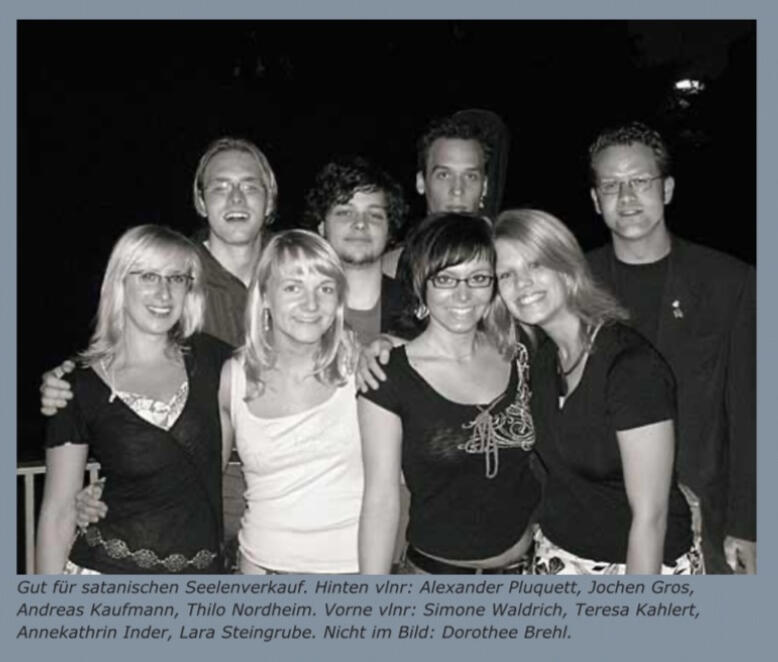
Alternierend zwischen virtuosem Solo und gekonnter chorischer Interaktion, präsentierte das neunköpfige Ensemble fünf satanische Varianten des Seelenverkaufs, von der barocken Ballade bis hin zur Ernst-Jandl-Adaption – ein teuflisches Kabinettstück, dessen Gelingen heftig bejubelt wurde. Eine Ouvertüre nach Maß, die vortrefflich auf den sechsten Teufelspakt einstimmte: "Die Geschichte vom Soldaten", Musiktheater von Charles F. Ramuz und Igor Strawinsky. Die Besetzung dieser prallen, Varietéatmosphäre ausstrahlenden, technisch allen Akteuren enorm viel abverlangende "Brettl-Oper" stellte, programmatisch für das Soundcheck-Konzept, eine gelungene Vernetzung diverser Gruppen dar. Im Orchester (Leitung: Andreas Cessak) mischten sich Lehrende der Fachrichtung Musik (Stefan Hülsermann, Klarinette; German Marstatt, Trompete; Olaf Pyras, Schlagzeug) mit Musikern aus dem Orchester des Staatstheaters zu einem beglückend homogenen Gesamtklang. Das Schauspielensemble (Regie: Reinhard Karger) setzte sich zusammen aus ehemaligen und aktuell Studierenden und einer professionellen Schauspielerin: Anja Haverland, welche den Part des Erzählers wohltuend mit rollenkompatibler Emotion auflud und so raffiniert den schneidigen "Ernst-Busch-Ton" vermied, der uns so oft von CD-Einspielungen entgegen quäkt. Susanne Schulz bezauberte als augenzwinkernd eitle Prinzessin, Timm Reitinger imponierte als leidend-kämpfender Soldat und Alexander Pluquett zeigte als teuflischer Irrwisch eine theatralisch wie akrobatisch gleichermaßen bewundernswerte Leistung. Ein dreimal trotz Fußballweltmeisterschaft prall gefüllter Saal bewies: Soundcheck hat sein Publikum gefunden.
music theatre
Die Orchesterprobe
Musiktheater von
Verena Joos und Reinhard Karger
2004/2005Die Orchesterprobe - Genese einer IdeeIch habe lange Jahre meines Arbeitslebens in Theatern verbracht, und von Anfang an hat mich besonders der Orchesterapparat fasziniert, nicht nur als Generator schöner und furchterregender Klänge, sondern auch als geschützter Lebensraum, in dem sich Menschen und Schwingungen auf einzigartige Weise begegnen. Wie ist es möglich, dass ein schlecht gelaunter Fagottist, der eben noch in der Kantine die übelsten Zoten gerissen hat, zehn Minuten später durch sein Spiel den edelsten Gefühlen Gestalt verleiht und das Publikum zu Tränen rührt? Was ist das für eine seltsame Gesellschaft, in der sich die verschiedenen Individuen und Interessengruppen genau wie im „richtigen Leben“ gegenseitig bekämpfen, und die doch übereinkommt, sich so zu disziplinieren, dass eine Botschaft über die Rampe oder aus dem Graben kommt, die alle Widersprüche aufhebt?
Früh wurde die Idee geboren, diesen modellhaften Kosmos mit all seinen grotesken und poetischen Verwerfungen einmal in einem Musiktheaterstück exemplarisch darzustellen. Erste Anregungen gab das Gastspiel der französischen Theatergruppe „Mie de pain“ Mitte der 80er-Jahre in Freiburg im Breisgau: dort wurde ein merkwürdiges Blockflötenorchester dargestellt, dessen durch und durch korrupte und intrigante Mitglieder keine Gemeinheit auslassen und schließlich den Dirigenten umbringen. Dann die Begegnung mit Karl Valentins „Orchesterprobe“: jegliche musikalische Bemühung scheitert am faulen und desinteressierten Trompeter, der es fertig bringt, während der ganzen Szene nicht einen einzigen Ton zu spielen. Und schließlich der berühmte Film von Federico Fellini: das Orchester als Modell für die politische und soziale Gemeinschaft und ihre Verwandlung im Lauf der Geschichte.
All diese „Patenideen“ haben lange im Hintergrund gearbeitet und gedrängt – und nun ist tatsächlich ein Stück draus geworden. Allerdings hätte es so das Licht der Bühnenwelt nie erblickt ohne die kongeniale Mitwirkung der Autorin Verena Joos, die die Szenerie in einem abgehalfterten Theaterbetrieb angesiedelt und den Darstellern die Texte auf den Leib geschrieben hat, sowie des Grafikers und Fotografen Thomas Huther, des Lichtdesigners Michael Koch und der Kostümbildnerin Sonja Huther. Ihnen und allen unseren Darstellern herzlichen Dank für die hingebungsvolle Geburtshilfe!
Kassel, im August 2005
Reinhard Karger

PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 12. September 2005Weil auch Töne lügen können"Die Orchesterprobe" von Verena Joos und Reinhard Karger im GloriaVon Dirk Schwarze
Ist das nicht alles Theater, was wir auf der Bühne sehen? Tun sich nicht hinter dem perfekten Zusammenspiel und der viel beschworenen Harmonie Abgründe auf? Das mag wohl sein. Jedenfalls stellen Verena Joos (Text) und Reinhard Karger (Musik und Regie) in ihrer neuen Revue „Orchesterprobe“ uns einen verlorenen Haufen von Musikern vor, die Harmonien erzeugen wollen, in Wahrheit aber untereinander Krieg führen. Das Premierenpublikum im fast voll besetzten Gloria ließ sich gut unterhalten und spendete begeistert Beifall.Verena Joos (Text) und Reinhard Karger (Musik) sind ein erprobtes Gespann. In der Verbindung von Sprechtheater und Musik haben sie für sich die Revue als Gestaltungsform entdeckt und mit zwei Produktionen („Ich will keine Schokolade“, „Schluss mit Lustig“) auf diesem Feld schon Erfolge eingeheimst. Ihre neue Produktion fügt der Selbstbespiegelung des Theaters durch den Blick auf das Probenspiel eine unterhaltsame Variante hinzu. Dabei ist der Anlass, aus dem sich die Geschichte entwickelt, erschreckend und bedrohlich: Ein Theater wurde geschlossen. Übrig geblieben ist ein siebenköpfiges Orchester, das noch ein Recht und die Pflicht zu Aufführungen hat. Aber weil die Lage so aussichtslos ist, wird die Musik, die an die Klänge eines Kurorchesters erinnert, von Trauer und Melancholie durchzogen.Immer wieder wird die Generalprobe unterbrochen, weil sich die Musiker gegenseitig nerven, weil sie einmal ihre Verzweiflung und Wut herausschreien müssen und weil sie in faszinierenden Soli zeigen können, dass sie auch ganz anderer Leistungen fähig sind. So entpuppt sich das Zusammenspiel als große Selbsttäuschung. Selbst die Hoffnung, dass ,Töne nicht lügen können, erweist sich als Illusion.Joos und Karger gelingt es, aus dem traurigen Szenarium eine Groteske zu machen, die wesentlich von der Musik getragen wird. Allerdings überfordert die Länge der über 100-minütigen Produktion den Text. Die Geschichte würde von einer deutlichen Verdichtung profitieren.Dass der Abend zu einer kurzweiligen Unterhaltung wurde, ist der Tatsache zu verdanken, dass Joos und Karger um sich ein hervorragendes Team versammelten. Die Musiker entfalteten sich als überzeugende Schauspieler, die eindringlich kauzige Charaktere vorführten.Unbestrittener Star war Hugo Scholz als penetrant belehrender Alban (Saxofon), dessen gepresste Redeweise unvergesslich bleibt. Aber auch Regine von Lühmann (Kontrabass), Maria Weber-Krüger (Geige), Jürgen Sprenger (Trompete), Kathrin Vogler (Akkordeon), Stefan Hülsermann (Klarinette) und Michael Knauff (E-Gitarre) setzten nicht nur musikalisch Glanzlichter, sondern gefielen auch als eine Ansammlung von Sonderlingen. Dass die Probe immer wieder in die Gänge kam, dafür sorgte Andrea Gloggner als Mädchen für alles. Ihr ganz persönliches und erotisches Verhältnis zu den Musikinstrumenten hatte den Boden für die Revue bereitet.
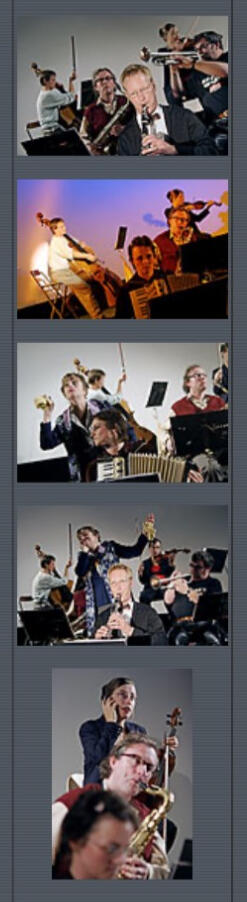
Theaterprojekte
Die Orchesterprobe
Musiktheater von
Verena Joos und Reinhard Karger
2004/2005Die Orchesterprobe - Genese einer IdeeIch habe lange Jahre meines Arbeitslebens in Theatern verbracht, und von Anfang an hat mich besonders der Orchesterapparat fasziniert, nicht nur als Generator schöner und furchterregender Klänge, sondern auch als geschützter Lebensraum, in dem sich Menschen und Schwingungen auf einzigartige Weise begegnen. Wie ist es möglich, dass ein schlecht gelaunter Fagottist, der eben noch in der Kantine die übelsten Zoten gerissen hat, zehn Minuten später durch sein Spiel den edelsten Gefühlen Gestalt verleiht und das Publikum zu Tränen rührt? Was ist das für eine seltsame Gesellschaft, in der sich die verschiedenen Individuen und Interessengruppen genau wie im „richtigen Leben“ gegenseitig bekämpfen, und die doch übereinkommt, sich so zu disziplinieren, dass eine Botschaft über die Rampe oder aus dem Graben kommt, die alle Widersprüche aufhebt?
Früh wurde die Idee geboren, diesen modellhaften Kosmos mit all seinen grotesken und poetischen Verwerfungen einmal in einem Musiktheaterstück exemplarisch darzustellen. Erste Anregungen gab das Gastspiel der französischen Theatergruppe „Mie de pain“ Mitte der 80er-Jahre in Freiburg im Breisgau: dort wurde ein merkwürdiges Blockflötenorchester dargestellt, dessen durch und durch korrupte und intrigante Mitglieder keine Gemeinheit auslassen und schließlich den Dirigenten umbringen. Dann die Begegnung mit Karl Valentins „Orchesterprobe“: jegliche musikalische Bemühung scheitert am faulen und desinteressierten Trompeter, der es fertig bringt, während der ganzen Szene nicht einen einzigen Ton zu spielen. Und schließlich der berühmte Film von Federico Fellini: das Orchester als Modell für die politische und soziale Gemeinschaft und ihre Verwandlung im Lauf der Geschichte.
All diese „Patenideen“ haben lange im Hintergrund gearbeitet und gedrängt – und nun ist tatsächlich ein Stück draus geworden. Allerdings hätte es so das Licht der Bühnenwelt nie erblickt ohne die kongeniale Mitwirkung der Autorin Verena Joos, die die Szenerie in einem abgehalfterten Theaterbetrieb angesiedelt und den Darstellern die Texte auf den Leib geschrieben hat, sowie des Grafikers und Fotografen Thomas Huther, des Lichtdesigners Michael Koch und der Kostümbildnerin Sonja Huther. Ihnen und allen unseren Darstellern herzlichen Dank für die hingebungsvolle Geburtshilfe!
Kassel, im August 2005
Reinhard Karger

PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 12. September 2005Weil auch Töne lügen können"Die Orchesterprobe" von Verena Joos und Reinhard Karger im GloriaVon Dirk Schwarze
Ist das nicht alles Theater, was wir auf der Bühne sehen? Tun sich nicht hinter dem perfekten Zusammenspiel und der viel beschworenen Harmonie Abgründe auf? Das mag wohl sein. Jedenfalls stellen Verena Joos (Text) und Reinhard Karger (Musik und Regie) in ihrer neuen Revue „Orchesterprobe“ uns einen verlorenen Haufen von Musikern vor, die Harmonien erzeugen wollen, in Wahrheit aber untereinander Krieg führen. Das Premierenpublikum im fast voll besetzten Gloria ließ sich gut unterhalten und spendete begeistert Beifall.Verena Joos (Text) und Reinhard Karger (Musik) sind ein erprobtes Gespann. In der Verbindung von Sprechtheater und Musik haben sie für sich die Revue als Gestaltungsform entdeckt und mit zwei Produktionen („Ich will keine Schokolade“, „Schluss mit Lustig“) auf diesem Feld schon Erfolge eingeheimst. Ihre neue Produktion fügt der Selbstbespiegelung des Theaters durch den Blick auf das Probenspiel eine unterhaltsame Variante hinzu. Dabei ist der Anlass, aus dem sich die Geschichte entwickelt, erschreckend und bedrohlich: Ein Theater wurde geschlossen. Übrig geblieben ist ein siebenköpfiges Orchester, das noch ein Recht und die Pflicht zu Aufführungen hat. Aber weil die Lage so aussichtslos ist, wird die Musik, die an die Klänge eines Kurorchesters erinnert, von Trauer und Melancholie durchzogen.Immer wieder wird die Generalprobe unterbrochen, weil sich die Musiker gegenseitig nerven, weil sie einmal ihre Verzweiflung und Wut herausschreien müssen und weil sie in faszinierenden Soli zeigen können, dass sie auch ganz anderer Leistungen fähig sind. So entpuppt sich das Zusammenspiel als große Selbsttäuschung. Selbst die Hoffnung, dass ,Töne nicht lügen können, erweist sich als Illusion.Joos und Karger gelingt es, aus dem traurigen Szenarium eine Groteske zu machen, die wesentlich von der Musik getragen wird. Allerdings überfordert die Länge der über 100-minütigen Produktion den Text. Die Geschichte würde von einer deutlichen Verdichtung profitieren.Dass der Abend zu einer kurzweiligen Unterhaltung wurde, ist der Tatsache zu verdanken, dass Joos und Karger um sich ein hervorragendes Team versammelten. Die Musiker entfalteten sich als überzeugende Schauspieler, die eindringlich kauzige Charaktere vorführten.Unbestrittener Star war Hugo Scholz als penetrant belehrender Alban (Saxofon), dessen gepresste Redeweise unvergesslich bleibt. Aber auch Regine von Lühmann (Kontrabass), Maria Weber-Krüger (Geige), Jürgen Sprenger (Trompete), Kathrin Vogler (Akkordeon), Stefan Hülsermann (Klarinette) und Michael Knauff (E-Gitarre) setzten nicht nur musikalisch Glanzlichter, sondern gefielen auch als eine Ansammlung von Sonderlingen. Dass die Probe immer wieder in die Gänge kam, dafür sorgte Andrea Gloggner als Mädchen für alles. Ihr ganz persönliches und erotisches Verhältnis zu den Musikinstrumenten hatte den Boden für die Revue bereitet.
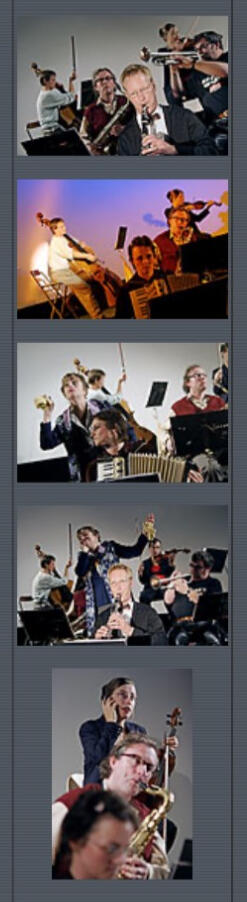
music theatre
Schluß mit lustig!
Eine Revue über die letzten Dingevon Verena Joos und Reinhard KargerDie Szene: ein Kirchhof. Zwischen Rasenbank und Elterngrab treffen sich allerhand merkwürdige Gestalten. Sie treiben mit Entsetzen Scherz und zeigen dem Klappergerüst den Stinkefinger. Sie sind getrieben von der Zodesangst – oder von der Zuversicht erfüllt, dem Tod zu gebotener Zeit ein Schnippchen schlagen zu können.
Musikalische und szenische Begegnungen an der Schwelle zum Nicht-mehr-Sein, poetisch und makaber, choralhaft und gassenhauerisch, lammfromm und rotzfrech. Eben: Die letzte Revue.
Danach gilt: Rien ne va plus ...Mit
Peter Anger, Verena Plangger,
Hugo W. Scholz, Susanne Schulz, Maria Weber-KrügerTexte: Verena JoosRegie und musikalische Arrangements: Reinhard Karger

PresseHessische/Niedersächsische Allgemeine – 8. September 2003Den Lebenden bleibt der Rhododendron"Schluss mit lustig!", droht eine vergnügliche Revue von Verena Joos und Reinhard Karger über die vorletzten DingeVon Werner FritschKASSEL. So saftig wie vor zweihundert Jahren klingen heutige Grabsprüche nicht mehr: "Hier ruhen meine Gebeine - ich wollt', es wären deine." Ein gutes Beispiel dafür, dass die Drohung "Schluss mit lustig!" auch nach dem Ableben nicht in jedem Fall verfängt. Allerdings: Es ist schon ein mitunter makaberer Humor, der in dieser "letzten Revue" von Verena Joos und Reinhard Karger im Theaterstübchen aufscheint. Trauernde gehören nicht unbedingt zur Zielgruppe.Die anderen aber erleben einen vergnüglichen bis besinnlichen Rundumschlag mit der Sense. Notwendigerweise sind es die noch Lebenden, die den prallsten Stoff abgeben. Hier ist es ein verwaistes Geschwisterpaar im vorgerückten Alter, das sich am Grab der Eltern gegenseitig alle Gemeinheiten centweise herausgibt, die bisher aufs Lebenskonto gebucht wurden. Verschärfte Loriot-Szenen, die Verena Joos dem brillanten Duo Verena Plangger (als zwanghafte Tochter Klara) und Peter Anger (als lebensuntüchtiger Sohn Max) auf den Leib geschrieben hat.Der Streit um ein Grabgewächs ist der Kristallisationspunkt für die beiden, die mit dem Tod der Eltern recht problemlos, mit dem eigenen Leben aber weniger gut zurecht kommen: "Der Rhododendron kommt weg!" - "Kommt er nicht!" - "Kommt er doch!"Humor schließt Hintergründigkeit ein, oder er wird albern. Verena Joos führt mit den witzigen Szenen stets auch an die Abgründe.Durch die Show irrlichtern neben den Geschwistern einige weitere Gestalten. Etwa ein Bestatter im Zylinder (Hugo W. Scholz), der seinem schwefelig-lasziven, Geige spielenden Lehrling Luzie (Maria Weber-Krüger) alles vom Körper-Reihengrab bis zum Urnen-Wahlgrab, von Liegezeit und Verrottung beibringt.Eine Untote namens Hermine (Susanne Schulz), eine Berliner Göre, die auf der Suche nach ihrem verblichenen Geliebten Friedrich Hollaenders "Lieder eines armen Mädchens" singt: "Wenn ick mal tot bin, ist mein schönster Tag."Reinhard Karger, der Regisseur und musikalische Arrangeur, führt alle Akteure immer wieder zusammen - zu innigem Chorgesang: Bachs Chorsatz "Komm, süßer Tod", Mendelssohns "Lebewohl du schöner Wald", dazu mundharmonikabegleitete Chansons lehren uns: Angesichts der letzten Dinge bleibt kein Auge trocken. So oder so.
Theaterprojekte
Schluß mit lustig!
Eine Revue über die letzten Dingevon Verena Joos und Reinhard KargerDie Szene: ein Kirchhof. Zwischen Rasenbank und Elterngrab treffen sich allerhand merkwürdige Gestalten. Sie treiben mit Entsetzen Scherz und zeigen dem Klappergerüst den Stinkefinger. Sie sind getrieben von der Zodesangst – oder von der Zuversicht erfüllt, dem Tod zu gebotener Zeit ein Schnippchen schlagen zu können.
Musikalische und szenische Begegnungen an der Schwelle zum Nicht-mehr-Sein, poetisch und makaber, choralhaft und gassenhauerisch, lammfromm und rotzfrech. Eben: Die letzte Revue.
Danach gilt: Rien ne va plus ...Mit
Peter Anger, Verena Plangger,
Hugo W. Scholz, Susanne Schulz, Maria Weber-KrügerTexte: Verena JoosRegie und musikalische Arrangements: Reinhard Karger

PresseHessische/Niedersächsische Allgemeine – 8. September 2003Den Lebenden bleibt der Rhododendron"Schluss mit lustig!", droht eine vergnügliche Revue von Verena Joos und Reinhard Karger über die vorletzten DingeVon Werner FritschKASSEL. So saftig wie vor zweihundert Jahren klingen heutige Grabsprüche nicht mehr: "Hier ruhen meine Gebeine - ich wollt', es wären deine." Ein gutes Beispiel dafür, dass die Drohung "Schluss mit lustig!" auch nach dem Ableben nicht in jedem Fall verfängt. Allerdings: Es ist schon ein mitunter makaberer Humor, der in dieser "letzten Revue" von Verena Joos und Reinhard Karger im Theaterstübchen aufscheint. Trauernde gehören nicht unbedingt zur Zielgruppe.Die anderen aber erleben einen vergnüglichen bis besinnlichen Rundumschlag mit der Sense. Notwendigerweise sind es die noch Lebenden, die den prallsten Stoff abgeben. Hier ist es ein verwaistes Geschwisterpaar im vorgerückten Alter, das sich am Grab der Eltern gegenseitig alle Gemeinheiten centweise herausgibt, die bisher aufs Lebenskonto gebucht wurden. Verschärfte Loriot-Szenen, die Verena Joos dem brillanten Duo Verena Plangger (als zwanghafte Tochter Klara) und Peter Anger (als lebensuntüchtiger Sohn Max) auf den Leib geschrieben hat.Der Streit um ein Grabgewächs ist der Kristallisationspunkt für die beiden, die mit dem Tod der Eltern recht problemlos, mit dem eigenen Leben aber weniger gut zurecht kommen: "Der Rhododendron kommt weg!" - "Kommt er nicht!" - "Kommt er doch!"Humor schließt Hintergründigkeit ein, oder er wird albern. Verena Joos führt mit den witzigen Szenen stets auch an die Abgründe.Durch die Show irrlichtern neben den Geschwistern einige weitere Gestalten. Etwa ein Bestatter im Zylinder (Hugo W. Scholz), der seinem schwefelig-lasziven, Geige spielenden Lehrling Luzie (Maria Weber-Krüger) alles vom Körper-Reihengrab bis zum Urnen-Wahlgrab, von Liegezeit und Verrottung beibringt.Eine Untote namens Hermine (Susanne Schulz), eine Berliner Göre, die auf der Suche nach ihrem verblichenen Geliebten Friedrich Hollaenders "Lieder eines armen Mädchens" singt: "Wenn ick mal tot bin, ist mein schönster Tag."Reinhard Karger, der Regisseur und musikalische Arrangeur, führt alle Akteure immer wieder zusammen - zu innigem Chorgesang: Bachs Chorsatz "Komm, süßer Tod", Mendelssohns "Lebewohl du schöner Wald", dazu mundharmonikabegleitete Chansons lehren uns: Angesichts der letzten Dinge bleibt kein Auge trocken. So oder so.
music theatre
upstairs - downstairs
Musiktheater mit RolltreppenEin Projekt von Bettina Köhler, Antje Weiler und Reinhard Kargerin Zusammenarbeit mit der Gesamthochschule Kassel, der Gesamtschule Heiligenrode und der Burgsitzschule SpangenbergEin Projekt für die Kasseler Musiktage 200160 Schülerinnen und Schüler entwickeln aufgrund von eigenen Beobachtungen in der Fußgängerzone kleine, "dem Alltag abgeschaute" Musiktheaterszenen - diese Szenen werden in einer genauen "Zeitpartitur" organisiert und während einer definierten Aufführungsdauer in einer bestimmten Einkaufszone immer wieder aufgeführt - und zwar während des normalen Einkaufsbetriebes, so daß die Grenzen zwischen bewußt Gestaltetem und zufällig Passierendem verschwimmen, jeder Passant kann plötzlich Teil einer Szene sein, jedes gestaltete Element kann auch als merkwürdige Alltagssituation wahrgenommen werden - eine ästhetische Gratwanderung zwischen Alltag und Kunst.
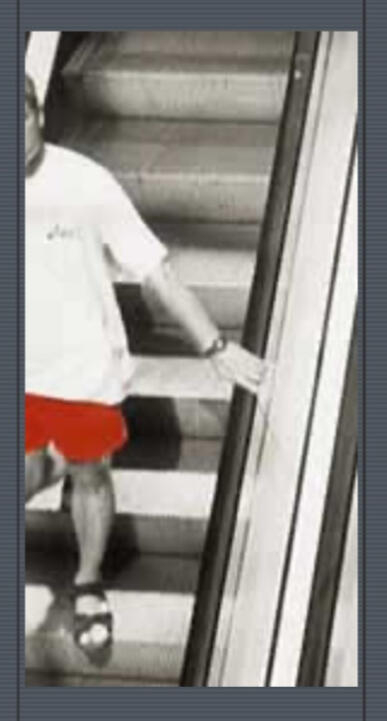
PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 29. Oktober 2001(...) Die Vermischung von Alltagswelt und künstlerischer Aktion am weitesten getrieben hatte der Kasseler Komponist Reinhard Karger mit der Musiktheateraktion Upstairs - Downstairs, bei der 60 Schüler in der Kurfürstengalerie 18 verschiedene Aktionen ausführten. Von der Strukturierung von Alltagssituationen (Joggerinnen, die sich synchron bewegen) über Fantasiefiguren (zwei Flamencogirls, ein Hochzeitspaar) bis hin zu musikalisch gestalteten Aktionen (der Stomp einer Putzkolonne, das Lied eines Straßenmusikers, das Perkussionsspiel eines Bautrupps, der die Alu-Klappleiter als Instrument benutzte) reichte das Spektrum. Und neben der Frage, wer denn nun Akteur oder unbeteiligter Passant war, stellte sich auf einmal eine zweite: Wer war gezielt hierher gekommen und wer war bloß zufällig hier? Das Publikum suchte sich zu erkennen.Wie wirkt gestaltete Aktion auf den Alltag ein, und wie verändert ein künstlerischer Eingriff den Blick auf den Alltag? Fragen, auf die es ebenso viele Antworten gibt wie an der Szene Beteiligte. Der Performance-Charakter von Upstairs -Downstairs jedenfalls brachte eine neue Haltung der Musiktage auf den Punkt. (...)
Werner Fritsch
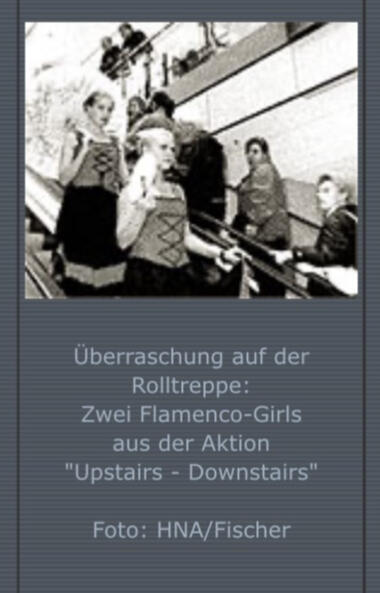
Theaterprojekte
upstairs - downstairs
Musiktheater mit RolltreppenEin Projekt von Bettina Köhler, Antje Weiler und Reinhard Kargerin Zusammenarbeit mit der Gesamthochschule Kassel, der Gesamtschule Heiligenrode und der Burgsitzschule SpangenbergEin Projekt für die Kasseler Musiktage 200160 Schülerinnen und Schüler entwickeln aufgrund von eigenen Beobachtungen in der Fußgängerzone kleine, "dem Alltag abgeschaute" Musiktheaterszenen - diese Szenen werden in einer genauen "Zeitpartitur" organisiert und während einer definierten Aufführungsdauer in einer bestimmten Einkaufszone immer wieder aufgeführt - und zwar während des normalen Einkaufsbetriebes, so daß die Grenzen zwischen bewußt Gestaltetem und zufällig Passierendem verschwimmen, jeder Passant kann plötzlich Teil einer Szene sein, jedes gestaltete Element kann auch als merkwürdige Alltagssituation wahrgenommen werden - eine ästhetische Gratwanderung zwischen Alltag und Kunst.
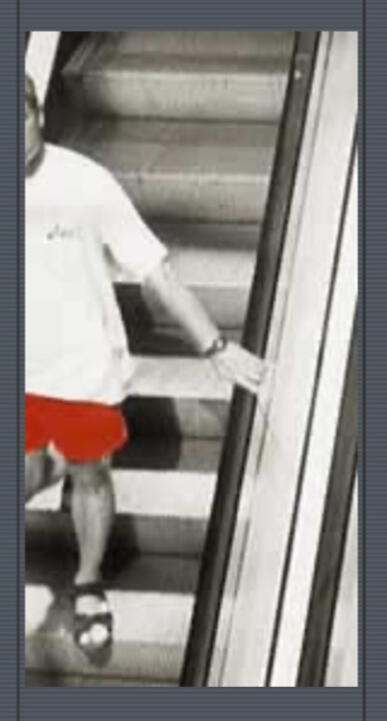
PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 29. Oktober 2001(...) Die Vermischung von Alltagswelt und künstlerischer Aktion am weitesten getrieben hatte der Kasseler Komponist Reinhard Karger mit der Musiktheateraktion Upstairs - Downstairs, bei der 60 Schüler in der Kurfürstengalerie 18 verschiedene Aktionen ausführten. Von der Strukturierung von Alltagssituationen (Joggerinnen, die sich synchron bewegen) über Fantasiefiguren (zwei Flamencogirls, ein Hochzeitspaar) bis hin zu musikalisch gestalteten Aktionen (der Stomp einer Putzkolonne, das Lied eines Straßenmusikers, das Perkussionsspiel eines Bautrupps, der die Alu-Klappleiter als Instrument benutzte) reichte das Spektrum. Und neben der Frage, wer denn nun Akteur oder unbeteiligter Passant war, stellte sich auf einmal eine zweite: Wer war gezielt hierher gekommen und wer war bloß zufällig hier? Das Publikum suchte sich zu erkennen.Wie wirkt gestaltete Aktion auf den Alltag ein, und wie verändert ein künstlerischer Eingriff den Blick auf den Alltag? Fragen, auf die es ebenso viele Antworten gibt wie an der Szene Beteiligte. Der Performance-Charakter von Upstairs -Downstairs jedenfalls brachte eine neue Haltung der Musiktage auf den Punkt. (...)
Werner Fritsch
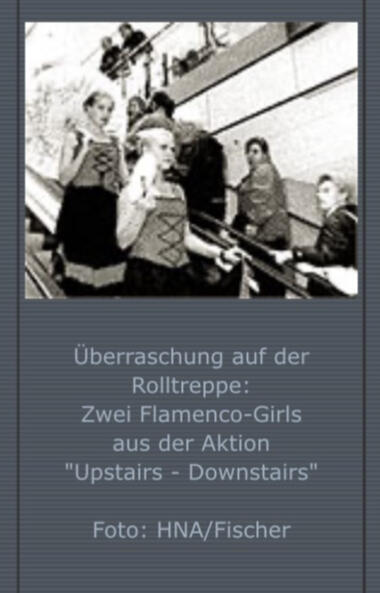
music theatre
Remedia Amoris - ein Männerkonzert
Musiktheater für 5 Schauspieler und eine Schauspielerin1999/2000Fünf Männer sitzen am Stammtisch und brüten vor sich hin, sie wollen ihre Ruhe haben, ihren Gedanken nachhängen und trinken; sie wollen eigentlich nichts miteinander zu tun haben, vermeiden Blickkontakt und körperliche Berührung, sie sprechen nicht miteinander...... trotzdem sind sie gerne da, sie brauchen die Stallwärme, das Gefühl, nicht allein zu sein, das Singen und den Alkohol...... sie treffen sich oft, sind aber doch "zusammen allein"......Das ist die theatralische Grundbehauptung von "remedia amoris": fünf Monologe im halböffentlichen Sprach-Raum "Stammtisch".Wie verhalten sich nun diese Monologe zueinander in der Zeit? Das ist eine Fragestellung, die dem Musiktheater entstammt, und hier nimmt die Vorstellung eines "Musiktheaters für Schauspieler" Ihren Anfang. Die Idee war, die Monologe kompositorisch zu organisieren, ich wollte die Schauspieler führen wie Orchesterinstrumente, wie fünf charakteristisch ausgeprägte Stimmen im Tonsatz in einem Bläserquintett weiß die Flöte nichts vom Horn, sie hat eine anders ausgeprägte Klangfarbe, sie erzählt eine völlig andere "Geschichte" als ihr tenoraler, von Post- und Waldassoziationen affizierter Kollege, und doch können sich beide wunderschön in! einen musikalischen Zusammenhang einfügen, ja sie konstituieren durch ihre Unterschiedlichkeit erst den gemeinsamen Klang. Genauso - so stellte ich mir vor -sollten diese fünf sehr verschiedenen Männer einen gemeinsamen Sprech- und Klangraum bilden, und so "zusammen" sein, obwohl jeder - als schauspielerisch gestaltete Figur - nur "für sich" ist.Die Rituale des Trinkens und Singens sind gespeist aus dem unerschöpflich reichen Fundus des deutschen Männerchores, dessen Entstehung in dieselbe Zeit fällt wie das Schaffen von Franz Schubert, der seinerseits - sozusagen als "Patengeschenk" - die musikalische Substanz unseres Hauptthemas beigesteuert hat.Für die Textsplitter, in denen das Erhabene und das Banale einen schrägen Pas-de-deux durch 2000 Jahre Männergeschichte tanzen', bin ich folgenden Personen zu besonderem Dank verpflichtet: In erster Linie Ilse, Hermann und Bernd Gieseking, die mich an einem etwas feuchten und sehr fröhlichen Nachmittag in Kudenhausen in das Thema einführten, sowie Verena Joos, ohne deren mannigfaltige Hinweise auf ihre exzellent sortierte Privatbibliothek das Stück so nicht entstanden wäre.Ein herzliches Dankeschön für textliche Anregungen geht außerdem an:
Ovid, Eckhard Krug, Eckhard Henscheid, Albertus Magnus, Johanna Joos,
Eugen Egner, Petra Hartmann, Gerd Koch, Michel Houellebecq,
Hanna und Bärbel Joos, Roald Zellweger und Roy Black.Reinhard Karger
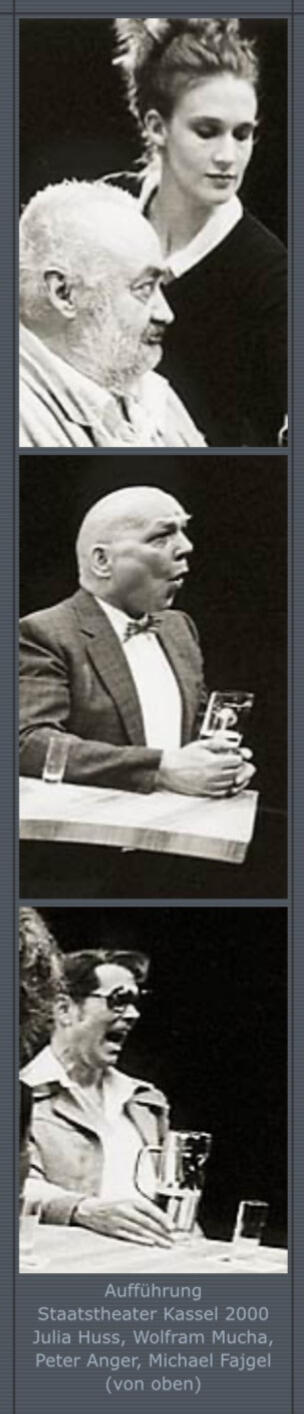
PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 17. April 2000URAUFFÜHRUNGDer Stammtisch wird MusikReinhard Kargers Musiktheater Remedia amoris, das in der Explosiv-Reihe des Staatstheaters im Frizz uraufgeführt wurde, sucht und findet die verletzte Männerseele am Stammtisch.Introduzione zeigt eine Leuchtschrift über der Bühne an. Dann sitzen da fünf Männer an einem halbrunden Tisch, vor sich Bier- und Schnapsglas. Minutenlang passiert nichts. Die fünf so unterschiedlichen Mannsbilder feiern ihre Gemeinschaft: sie brüten vor sich hin. Aus dieser dichten Stille entsteht ein Summen, erst einstimmig, dann fallen die anderen mit ein, und schließlich singen die Männer im fünfstimmigen Satz ein süddeutsches Wirtshauslied: Wir gehn nicht heim, wir bleiben da.Erster Satz eines Musiktheaterstücks, mit dem der Kasseler Komponist Reinhard Karger nicht lediglich eine Handlung vertont oder musikalisch kommentiert, sondern die Handlung selbst zum Klingen bringt: im Männerchorgesang, im Sprechen, im Lachen, im Schimpfen, im Weinen, im Schweigen. Und zwar in der formalen Gestaltung einer klassischen Komposition mit einer Abfolge von Sätzen: Der Stammtisch wird Musik. Nicht immer so formal streng wie im Scherzo, einem langen An- und Abschwellen von Gelächter, in dem sich die Stimmen zu einem polyrhythmischen Lachstück vereinen.Die fünf Männer werden von Schauspielern und nicht von Sängern verkörpert, denn es handelt sich, wie der Untertitel sagt, um ein Männerkonzert, ein Konzert der Männer und nicht von Musikern. Jeder hat seine Stimme und seine Geschichte: Einer war mal Schlagersänger, lang ists her, dass er Briefe von Bewunderinnen kriegte. Michael Fajgel spielt ihn in dandyhafter Verzweiflung.Ein anderer, jung, langhaarig, (Daniel Schäfer) hat merkwürdige, religiös verbrämte Fantasien über Frauen. Der nächste träumte von einer Theaterkarriere, bevor er als Darsteller in Schulungsfilmen endete, Herwig Lucas verkörpert ihn eindrucksvoll als Virtuosen leerer Worthülsen. Wolfram Mucha ist ein alter Fußballer, der noch immer dem verlorenen Wembley-Endspiel von 1966 nachhängt, in Wahrheit aber einer verlorenen Liebe nachtrauert. Und schließlich Peter Anger als ehemaliger Lehrer, der von peinlichen Erinnerungen an sexuelle Verfehlungen mit einer Schülerin geplagt wird.
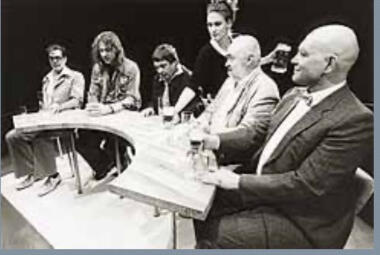
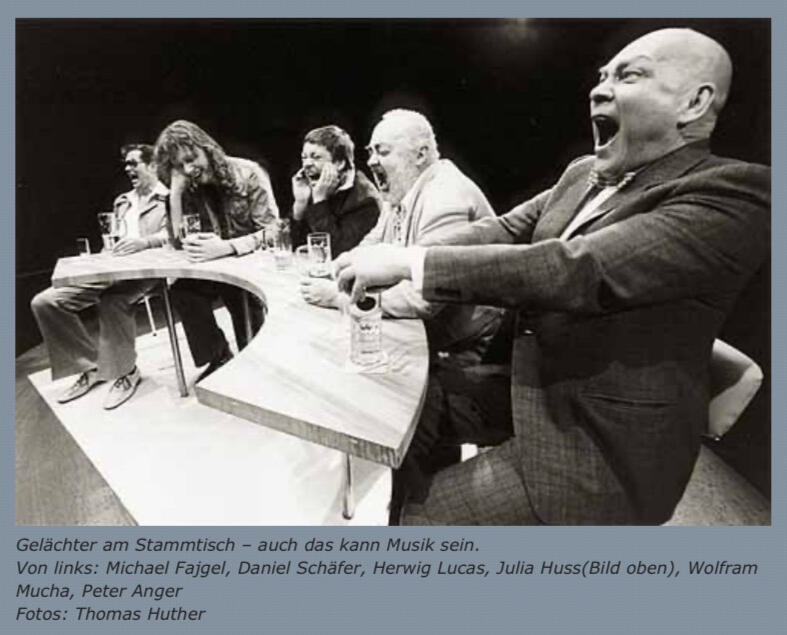
Karger und die Darsteller entwickelten aus diesem Stoff fünf Monologe, denn zusammen kommen die Stammtischler nur in den Trinksprüchen und im gemeinsamen Singen. Genauso statisch wie die schwerblütigen Lieder ist der Stammtisch insgesamt, der ja nur eine Bewegung kennt: den Durchfluss des Bieres. Eine junge Bedienung (Julia Huss), von den Männern stumm begehrt, bringt den Nachschub, entsorgen im Pissoir müssen die Herren selbst.Karger gelingt es eindrucksvoll, alles Groteske, alles Elend dieser letztlich liebeskranken Figuren im Sentiment des Männerchores zu bündeln. Nicht nur, dass die Schauspieler die vollstimmigen Gesänge vom Weserlied bis Röslein rot wunderbar bewältigen, es klingt darin ein fast vormusikalischer Ton an von Klage und Besänftigung. Karger findet diesen Ton ganz ursprünglich bei Schubert. Unterlegt mit Ovids Remedia amoris (Heilmittel gegen die Liebe), wirkt das Adagio aus Schuberts c-moll-Klaviersonate im Chorsatz wie eine Keimzelle jener sehnsuchtsvollen Romantik, die zum Kern deutscher Innerlichkeit gehört. Sie ist nicht eigentlich lebensfroh, sondern will erlittene Verwundungen heilen. Und nie ist es weit bis zum Umschlagen in Aggression. Auch davon könnte man ein Lied singen.Werner Fritsch
Theaterprojekte
Remedia Amoris - ein Männerkonzert
Musiktheater für 5 Schauspieler und eine Schauspielerin1999/2000Fünf Männer sitzen am Stammtisch und brüten vor sich hin, sie wollen ihre Ruhe haben, ihren Gedanken nachhängen und trinken; sie wollen eigentlich nichts miteinander zu tun haben, vermeiden Blickkontakt und körperliche Berührung, sie sprechen nicht miteinander...... trotzdem sind sie gerne da, sie brauchen die Stallwärme, das Gefühl, nicht allein zu sein, das Singen und den Alkohol...... sie treffen sich oft, sind aber doch "zusammen allein"......Das ist die theatralische Grundbehauptung von "remedia amoris": fünf Monologe im halböffentlichen Sprach-Raum "Stammtisch".Wie verhalten sich nun diese Monologe zueinander in der Zeit? Das ist eine Fragestellung, die dem Musiktheater entstammt, und hier nimmt die Vorstellung eines "Musiktheaters für Schauspieler" Ihren Anfang. Die Idee war, die Monologe kompositorisch zu organisieren, ich wollte die Schauspieler führen wie Orchesterinstrumente, wie fünf charakteristisch ausgeprägte Stimmen im Tonsatz in einem Bläserquintett weiß die Flöte nichts vom Horn, sie hat eine anders ausgeprägte Klangfarbe, sie erzählt eine völlig andere "Geschichte" als ihr tenoraler, von Post- und Waldassoziationen affizierter Kollege, und doch können sich beide wunderschön in! einen musikalischen Zusammenhang einfügen, ja sie konstituieren durch ihre Unterschiedlichkeit erst den gemeinsamen Klang. Genauso - so stellte ich mir vor -sollten diese fünf sehr verschiedenen Männer einen gemeinsamen Sprech- und Klangraum bilden, und so "zusammen" sein, obwohl jeder - als schauspielerisch gestaltete Figur - nur "für sich" ist.Die Rituale des Trinkens und Singens sind gespeist aus dem unerschöpflich reichen Fundus des deutschen Männerchores, dessen Entstehung in dieselbe Zeit fällt wie das Schaffen von Franz Schubert, der seinerseits - sozusagen als "Patengeschenk" - die musikalische Substanz unseres Hauptthemas beigesteuert hat.Für die Textsplitter, in denen das Erhabene und das Banale einen schrägen Pas-de-deux durch 2000 Jahre Männergeschichte tanzen', bin ich folgenden Personen zu besonderem Dank verpflichtet: In erster Linie Ilse, Hermann und Bernd Gieseking, die mich an einem etwas feuchten und sehr fröhlichen Nachmittag in Kudenhausen in das Thema einführten, sowie Verena Joos, ohne deren mannigfaltige Hinweise auf ihre exzellent sortierte Privatbibliothek das Stück so nicht entstanden wäre.Ein herzliches Dankeschön für textliche Anregungen geht außerdem an:
Ovid, Eckhard Krug, Eckhard Henscheid, Albertus Magnus, Johanna Joos,
Eugen Egner, Petra Hartmann, Gerd Koch, Michel Houellebecq,
Hanna und Bärbel Joos, Roald Zellweger und Roy Black.Reinhard Karger
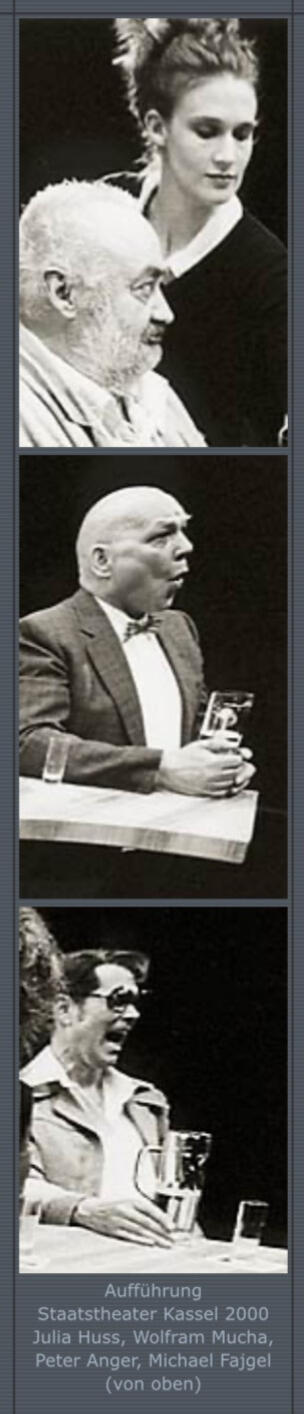
PRESSEHessische / Niedersächsische Allgemeine, 17. April 2000URAUFFÜHRUNGDer Stammtisch wird MusikReinhard Kargers Musiktheater Remedia amoris, das in der Explosiv-Reihe des Staatstheaters im Frizz uraufgeführt wurde, sucht und findet die verletzte Männerseele am Stammtisch.Introduzione zeigt eine Leuchtschrift über der Bühne an. Dann sitzen da fünf Männer an einem halbrunden Tisch, vor sich Bier- und Schnapsglas. Minutenlang passiert nichts. Die fünf so unterschiedlichen Mannsbilder feiern ihre Gemeinschaft: sie brüten vor sich hin. Aus dieser dichten Stille entsteht ein Summen, erst einstimmig, dann fallen die anderen mit ein, und schließlich singen die Männer im fünfstimmigen Satz ein süddeutsches Wirtshauslied: Wir gehn nicht heim, wir bleiben da.Erster Satz eines Musiktheaterstücks, mit dem der Kasseler Komponist Reinhard Karger nicht lediglich eine Handlung vertont oder musikalisch kommentiert, sondern die Handlung selbst zum Klingen bringt: im Männerchorgesang, im Sprechen, im Lachen, im Schimpfen, im Weinen, im Schweigen. Und zwar in der formalen Gestaltung einer klassischen Komposition mit einer Abfolge von Sätzen: Der Stammtisch wird Musik. Nicht immer so formal streng wie im Scherzo, einem langen An- und Abschwellen von Gelächter, in dem sich die Stimmen zu einem polyrhythmischen Lachstück vereinen.Die fünf Männer werden von Schauspielern und nicht von Sängern verkörpert, denn es handelt sich, wie der Untertitel sagt, um ein Männerkonzert, ein Konzert der Männer und nicht von Musikern. Jeder hat seine Stimme und seine Geschichte: Einer war mal Schlagersänger, lang ists her, dass er Briefe von Bewunderinnen kriegte. Michael Fajgel spielt ihn in dandyhafter Verzweiflung.Ein anderer, jung, langhaarig, (Daniel Schäfer) hat merkwürdige, religiös verbrämte Fantasien über Frauen. Der nächste träumte von einer Theaterkarriere, bevor er als Darsteller in Schulungsfilmen endete, Herwig Lucas verkörpert ihn eindrucksvoll als Virtuosen leerer Worthülsen. Wolfram Mucha ist ein alter Fußballer, der noch immer dem verlorenen Wembley-Endspiel von 1966 nachhängt, in Wahrheit aber einer verlorenen Liebe nachtrauert. Und schließlich Peter Anger als ehemaliger Lehrer, der von peinlichen Erinnerungen an sexuelle Verfehlungen mit einer Schülerin geplagt wird.
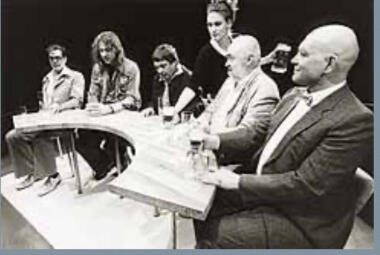
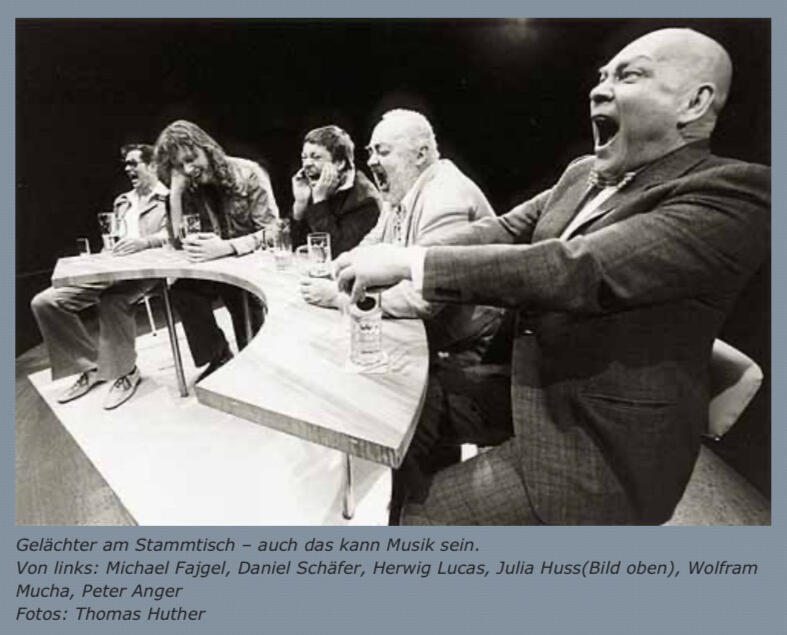
Karger und die Darsteller entwickelten aus diesem Stoff fünf Monologe, denn zusammen kommen die Stammtischler nur in den Trinksprüchen und im gemeinsamen Singen. Genauso statisch wie die schwerblütigen Lieder ist der Stammtisch insgesamt, der ja nur eine Bewegung kennt: den Durchfluss des Bieres. Eine junge Bedienung (Julia Huss), von den Männern stumm begehrt, bringt den Nachschub, entsorgen im Pissoir müssen die Herren selbst.Karger gelingt es eindrucksvoll, alles Groteske, alles Elend dieser letztlich liebeskranken Figuren im Sentiment des Männerchores zu bündeln. Nicht nur, dass die Schauspieler die vollstimmigen Gesänge vom Weserlied bis Röslein rot wunderbar bewältigen, es klingt darin ein fast vormusikalischer Ton an von Klage und Besänftigung. Karger findet diesen Ton ganz ursprünglich bei Schubert. Unterlegt mit Ovids Remedia amoris (Heilmittel gegen die Liebe), wirkt das Adagio aus Schuberts c-moll-Klaviersonate im Chorsatz wie eine Keimzelle jener sehnsuchtsvollen Romantik, die zum Kern deutscher Innerlichkeit gehört. Sie ist nicht eigentlich lebensfroh, sondern will erlittene Verwundungen heilen. Und nie ist es weit bis zum Umschlagen in Aggression. Auch davon könnte man ein Lied singen.Werner Fritsch
music theatre
Fußgängerzone
Musiktheater für 7 Sänger, 6 Schauspieler,
4 Straßenmusiker und kleines Orchester1990/91Chaos und Ordnung- Von heiligen und profanen Klängen -
In der Fußgängerzone sind alle gleich. Wo sonst die Unterschiede in Beruf und gesellschaftlichem Stand die Beziehungen zwischen den Menschen ordnen und bestimmen, verschwimmen in der Fußgängerzone die Grenzen, an die Stelle der hierarchischen Vorstellung ("jeder an seinem Platz") tritt ein chaotisches "demokratisches" Bild: Hier ist jeder ein König. denn ein jeder ist ein Kunde. Es ist unerheblich. ob du politisch rechts oder links stehst, ob du blitzgescheit oder strohdumm bist, ob du Hölderlin gelesen hast oder nicht - Hauptsache, du kaufst, die weiteren individuellen Bestimmungen deiner Person sind nicht gefragt. Das Geld
- das man hat oder eben nicht hat - ist das einzige differenzierende Regulativ, die Kultur der Fußgängerzone ist eine Wirtschaftskultur. Und die Abenteuer, die der Erlebnissamstag verspricht, sind erst dann erfolgreich bestanden, wenn der König Kunde am Abend mit prallen Einkaufstaschen, erschöpft, aber glücklich, über die heimische Schwelle wankt und sich darüber freut, daß er durch die heutigen Schnäppchen wieder so viel Geld gespart hat. Und der alte Streit, ob nun das Sein das Bewußtsein bestimme oder umgekehrt, endet unentschieden, denn hier bestimmt das Geld das Sein und das Bewußtsein.So durchdringen sich in der Fußgängerzone chaotische und ordnende Kräfte auf sehr eigentümliche Weise: das aufgelöste, scheinbar demokratische äußere Gewand ist im Innern durchdrungen von den klaren, harten Ordnungen der wirtschaftlichen Systeme. Wie sich dieses Verhältnis von Chaos und Ordnung auf der Ebene der Komposition widerspiegelt, möchte ich an zwei Beispielen darlegen: Die beiden Schlagzeuger bedienen keine üblichen Schlaginstrumente, sondern Bierflasche, Coladose, Metallhaken, Plastiktopf, Schuhe, Schlüsselbund etc.; diese Materialien, normalerweise eher mit dem Mülleimer als mit dem Reich der Musik in Verbindung gebracht, kommen auf die verschiedenste Weise in Kontakt mit einer Betonplatte; so werden chaotische, zum Teil nicht genau vorhersehbare Klänge erzeugt.. Für das traditionell geschulte, musikalische Ohr sind diese Klänge nicht verwertbar, es sind Abfallklänge. Doch genau so, wie die Aufhebung der gesellschaftlichen Hierarchien in der Fußgängerzone alle Menschen zu Hauptpersonen macht, können diese Abfallklänge zu vollwertigen Mitgliedern der musikalischen Familie er-hört werden, die ordnende Kraft des Hörens schließt zusammen mit der ordnenden Kraft des Komponierens das Chaos in den musikalischen Zusammenhang ein und entlockt so dem vermeintlich wertlosen Abfall ungeahntes Potential für neue Baustoffe.Umgekehrt ist der Sachverhalt bei den vier "Straßenmusikern" (in der Besetzung Mundharmonika, Geige, Gitarre und Akkordeon), Figuren, die schon immer in der Fußgängerzone leben und praktisch mit diesem Ort verwachsen sind. Sie sind sozusagen Teil des Bühnenbildes und verkörpern mit leisen, sphärischen Tönen den Klang des Raumes selbst. Jeder "Straßenmusiker" hat nun mehrere Abschnitte zu spielen, die jeweils in sich klanglich sehr differenziert auskomponiert sind. Hier ist also im Detail ein sehr hoher Ordnungsgrad vorhanden, und es erfordert viel Konzentration, die Abschnitte richtig zu spielen. Die Länge der Pausen zwischen den Abschnitten und die Reihenfolge der Abschnitte ist aber .ganz freigestellt, so daß man nie vorher weiß, welches Instrument nun mit welchem anderen wie zusammenklingen wird. Das im Innern sehr klar geordnete Material wird also im Zusammenspiel dem Zufall überantwortet, die reinen, "heiligen" Klänge werden unvorhersehbar vermischt, und so erhält auch hier das Chaos - auf entgegengesetzte Weise wie bei den Schlagzeugern - sein Wirkungsfeld. So bilden sich die beiden Prinzipien auf vielfältige Weise in der Komposition ab und definieren auf ihre Weise einen neuen Klangkosmos, "schöne" und "häßliche" Klänge durchdringen sich - die Karten werden neu
gemischt.Reinhard Karger
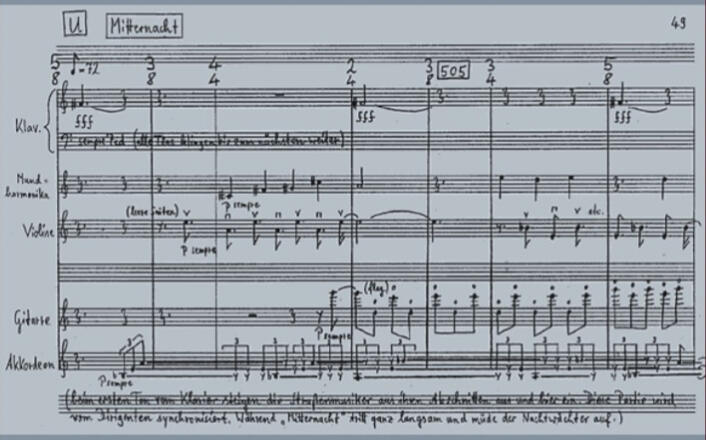
PresseGießener Allgemeine, Mai 1992Heutzutage besitzt sie jede größere Stadt; Kassel jedoch hatte sie zuerst: eine Fußgängerzone. Nicht zuletzt deshalb fand jetzt die Uraufführung einer Oper mit diesem Titel gerade hier statt. "Fußgängerzone", ein Auftragswerk für das Staatstheater Kassel anläßlich der documenta 92, spiegelt die visuellen und akustischen Beobachtungen, die der Komponist Reinhard Karger und der Texter Bernd Gieseking "vor Ort" gemacht haben.
Dabei entstand keine herkömmliche Oper mit einer durchgehenden dramatischen Handlung, sondern ein Musiktheaterstück, das in Libretto und Komposition die fragmentarische Wahrnehmungsweise eines Zufallspassanten wiedergibt. Kurzszenen überlagern sich hier mit realen, ,,abgelauschten" Dialogfetzen und frei erfundenen Texten. Es ergibt sich so eine vielschichtige szenische Collage aus Skurrilitäten und Plattitüden, aber auch dem Leben abgeschauten Realien, die zwar karikieren. deshalb jedoch aufrütteln und nachdenklich machen. Denn inmitten der pulsierenden Dynamik der Einkaufszone bleibt das elementarste Bedürfnis des Menschen, die Kommunikation. auf der Strecke, Da scheitern nicht nur Randexistenzen wie der Obdachlose, sondern auch Frau Schmidt, deren Frage nach der Uhrzeit ein versteckter Hilfe. ruf nach menschlicher Zuwendung ist.
(...)
Ruhe und Hektik, Ordnung und Chaos - nicht nur szenisch bewegt sich Reinhard Kargers Oper zwischen diesen Polen. Auf der Kompositionsebene treten ,,ordentliche", dem Ohr vertraute Klänge neben musikalische ,,Abfalltöne". Eine Bierflasche, eine Coladose oder ein Schlüsselbund erzeugen durch den Kontakt mit einer Betonplatte allerlei ungewöhnliche Geräusche. die sich mit dem mischen, was ein traditionell besetztes elfköpfiges Orchester erwarten läßt. Nach dem gleichen Prinzip. welches das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Personen in der Fußgängerzone bewirkt, wird hier auch der musikalische Zusammenklang dem Zufall überantwortet.
Das Ineinandergreifen und Sich-Ergänzen von Musik und szenischer Darstellung stellt besondere Aufgaben an die Ausfuhrenden. Zumal es sich hier um eine Oper handelt, m der nicht, wie sonst üblich, die Sänger den Ton angeben, sondern ein gleichberechtigtes Miteinander von Sängern und Schauspielern gefordert wird. Der Komponist Reinhard Karger, der Autor Bernd Gieseking und die Dramaturgin Verena Joos können diesbezüglich mit ihrem gemeinsam erarbeiteten Oeuvre zufrieden sein. Die gleiche Kooperationsbereitschaft wie zwischen den ~Machern.. zeigte sich auch auf der Ebene der Akteure Ein interessante, in sich stimmige Produktion. der man über diese Uraufführung hinaus viel Erfolg - nicht nur in Kassel - prophezeien kann.
Angela Maaßenentsteht ein Summen, erst einstimmig, dann fallen die anderen mit ein, und schließlich singen die Männer im fünfstimmigen Satz ein süddeutsches Wirtshauslied: Wir gehn nicht heim, wir bleiben da.Erster Satz eines Musiktheaterstücks, mit dem der Kasseler Komponist Reinhard Karger nicht lediglich eine Handlung vertont oder musikalisch kommentiert, sondern die Handlung selbst zum Klingen bringt: im Männerchorgesang, im Sprechen, im Lachen, im Schimpfen, im Weinen, im Schweigen. Und zwar in der formalen Gestaltung einer klassischen Komposition mit einer Abfolge von Sätzen: Der Stammtisch wird Musik. Nicht immer so formal streng wie im Scherzo, einem langen An- und Abschwellen von Gelächter, in dem sich die Stimmen zu einem polyrhythmischen Lachstück vereinen.Die fünf Männer werden von Schauspielern und nicht von Sängern verkörpert, denn es handelt sich, wie der Untertitel sagt, um ein Männerkonzert, ein Konzert der Männer und nicht von Musikern. Jeder hat seine Stimme und seine Geschichte: Einer war mal Schlagersänger, lang ists her, dass er Briefe von Bewunderinnen kriegte. Michael Fajgel spielt ihn in dandyhafter Verzweiflung.Ein anderer, jung, langhaarig, (Daniel Schäfer) hat merkwürdige, religiös verbrämte Fantasien über Frauen. Der nächste träumte von einer Theaterkarriere, bevor er als Darsteller in Schulungsfilmen endete, Herwig Lucas verkörpert ihn eindrucksvoll als Virtuosen leerer Worthülsen. Wolfram Mucha ist ein alter Fußballer, der noch immer dem verlorenen Wembley-Endspiel von 1966 nachhängt, in Wahrheit aber einer verlorenen Liebe nachtrauert. Und schließlich Peter Anger als ehemaliger Lehrer, der von peinlichen Erinnerungen an sexuelle Verfehlungen mit einer Schülerin geplagt wird.
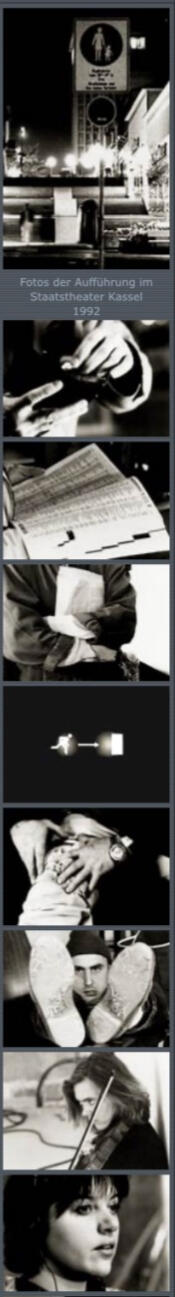
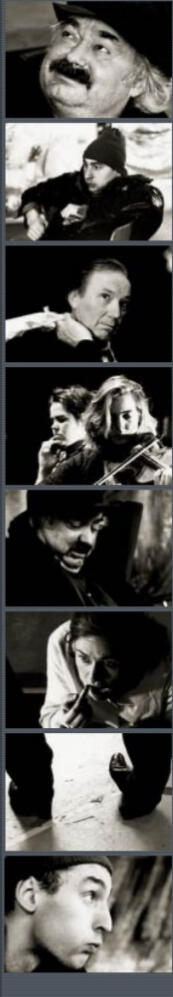
Theaterprojekte
Fußgängerzone
Musiktheater für 7 Sänger, 6 Schauspieler,
4 Straßenmusiker und kleines Orchester1990/91Chaos und Ordnung- Von heiligen und profanen Klängen -
In der Fußgängerzone sind alle gleich. Wo sonst die Unterschiede in Beruf und gesellschaftlichem Stand die Beziehungen zwischen den Menschen ordnen und bestimmen, verschwimmen in der Fußgängerzone die Grenzen, an die Stelle der hierarchischen Vorstellung ("jeder an seinem Platz") tritt ein chaotisches "demokratisches" Bild: Hier ist jeder ein König. denn ein jeder ist ein Kunde. Es ist unerheblich. ob du politisch rechts oder links stehst, ob du blitzgescheit oder strohdumm bist, ob du Hölderlin gelesen hast oder nicht - Hauptsache, du kaufst, die weiteren individuellen Bestimmungen deiner Person sind nicht gefragt. Das Geld
- das man hat oder eben nicht hat - ist das einzige differenzierende Regulativ, die Kultur der Fußgängerzone ist eine Wirtschaftskultur. Und die Abenteuer, die der Erlebnissamstag verspricht, sind erst dann erfolgreich bestanden, wenn der König Kunde am Abend mit prallen Einkaufstaschen, erschöpft, aber glücklich, über die heimische Schwelle wankt und sich darüber freut, daß er durch die heutigen Schnäppchen wieder so viel Geld gespart hat. Und der alte Streit, ob nun das Sein das Bewußtsein bestimme oder umgekehrt, endet unentschieden, denn hier bestimmt das Geld das Sein und das Bewußtsein.So durchdringen sich in der Fußgängerzone chaotische und ordnende Kräfte auf sehr eigentümliche Weise: das aufgelöste, scheinbar demokratische äußere Gewand ist im Innern durchdrungen von den klaren, harten Ordnungen der wirtschaftlichen Systeme. Wie sich dieses Verhältnis von Chaos und Ordnung auf der Ebene der Komposition widerspiegelt, möchte ich an zwei Beispielen darlegen: Die beiden Schlagzeuger bedienen keine üblichen Schlaginstrumente, sondern Bierflasche, Coladose, Metallhaken, Plastiktopf, Schuhe, Schlüsselbund etc.; diese Materialien, normalerweise eher mit dem Mülleimer als mit dem Reich der Musik in Verbindung gebracht, kommen auf die verschiedenste Weise in Kontakt mit einer Betonplatte; so werden chaotische, zum Teil nicht genau vorhersehbare Klänge erzeugt.. Für das traditionell geschulte, musikalische Ohr sind diese Klänge nicht verwertbar, es sind Abfallklänge. Doch genau so, wie die Aufhebung der gesellschaftlichen Hierarchien in der Fußgängerzone alle Menschen zu Hauptpersonen macht, können diese Abfallklänge zu vollwertigen Mitgliedern der musikalischen Familie er-hört werden, die ordnende Kraft des Hörens schließt zusammen mit der ordnenden Kraft des Komponierens das Chaos in den musikalischen Zusammenhang ein und entlockt so dem vermeintlich wertlosen Abfall ungeahntes Potential für neue Baustoffe.Umgekehrt ist der Sachverhalt bei den vier "Straßenmusikern" (in der Besetzung Mundharmonika, Geige, Gitarre und Akkordeon), Figuren, die schon immer in der Fußgängerzone leben und praktisch mit diesem Ort verwachsen sind. Sie sind sozusagen Teil des Bühnenbildes und verkörpern mit leisen, sphärischen Tönen den Klang des Raumes selbst. Jeder "Straßenmusiker" hat nun mehrere Abschnitte zu spielen, die jeweils in sich klanglich sehr differenziert auskomponiert sind. Hier ist also im Detail ein sehr hoher Ordnungsgrad vorhanden, und es erfordert viel Konzentration, die Abschnitte richtig zu spielen. Die Länge der Pausen zwischen den Abschnitten und die Reihenfolge der Abschnitte ist aber .ganz freigestellt, so daß man nie vorher weiß, welches Instrument nun mit welchem anderen wie zusammenklingen wird. Das im Innern sehr klar geordnete Material wird also im Zusammenspiel dem Zufall überantwortet, die reinen, "heiligen" Klänge werden unvorhersehbar vermischt, und so erhält auch hier das Chaos - auf entgegengesetzte Weise wie bei den Schlagzeugern - sein Wirkungsfeld. So bilden sich die beiden Prinzipien auf vielfältige Weise in der Komposition ab und definieren auf ihre Weise einen neuen Klangkosmos, "schöne" und "häßliche" Klänge durchdringen sich - die Karten werden neu
gemischt.Reinhard Karger
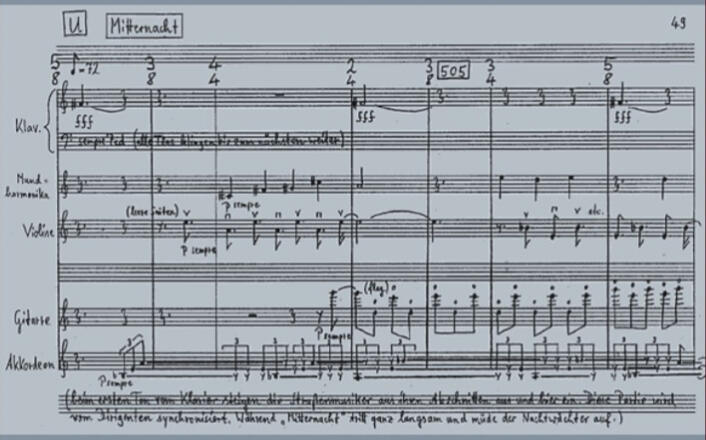
PresseGießener Allgemeine, Mai 1992Heutzutage besitzt sie jede größere Stadt; Kassel jedoch hatte sie zuerst: eine Fußgängerzone. Nicht zuletzt deshalb fand jetzt die Uraufführung einer Oper mit diesem Titel gerade hier statt. "Fußgängerzone", ein Auftragswerk für das Staatstheater Kassel anläßlich der documenta 92, spiegelt die visuellen und akustischen Beobachtungen, die der Komponist Reinhard Karger und der Texter Bernd Gieseking "vor Ort" gemacht haben.
Dabei entstand keine herkömmliche Oper mit einer durchgehenden dramatischen Handlung, sondern ein Musiktheaterstück, das in Libretto und Komposition die fragmentarische Wahrnehmungsweise eines Zufallspassanten wiedergibt. Kurzszenen überlagern sich hier mit realen, ,,abgelauschten" Dialogfetzen und frei erfundenen Texten. Es ergibt sich so eine vielschichtige szenische Collage aus Skurrilitäten und Plattitüden, aber auch dem Leben abgeschauten Realien, die zwar karikieren. deshalb jedoch aufrütteln und nachdenklich machen. Denn inmitten der pulsierenden Dynamik der Einkaufszone bleibt das elementarste Bedürfnis des Menschen, die Kommunikation. auf der Strecke, Da scheitern nicht nur Randexistenzen wie der Obdachlose, sondern auch Frau Schmidt, deren Frage nach der Uhrzeit ein versteckter Hilfe. ruf nach menschlicher Zuwendung ist.
(...)
Ruhe und Hektik, Ordnung und Chaos - nicht nur szenisch bewegt sich Reinhard Kargers Oper zwischen diesen Polen. Auf der Kompositionsebene treten ,,ordentliche", dem Ohr vertraute Klänge neben musikalische ,,Abfalltöne". Eine Bierflasche, eine Coladose oder ein Schlüsselbund erzeugen durch den Kontakt mit einer Betonplatte allerlei ungewöhnliche Geräusche. die sich mit dem mischen, was ein traditionell besetztes elfköpfiges Orchester erwarten läßt. Nach dem gleichen Prinzip. welches das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Personen in der Fußgängerzone bewirkt, wird hier auch der musikalische Zusammenklang dem Zufall überantwortet.
Das Ineinandergreifen und Sich-Ergänzen von Musik und szenischer Darstellung stellt besondere Aufgaben an die Ausfuhrenden. Zumal es sich hier um eine Oper handelt, m der nicht, wie sonst üblich, die Sänger den Ton angeben, sondern ein gleichberechtigtes Miteinander von Sängern und Schauspielern gefordert wird. Der Komponist Reinhard Karger, der Autor Bernd Gieseking und die Dramaturgin Verena Joos können diesbezüglich mit ihrem gemeinsam erarbeiteten Oeuvre zufrieden sein. Die gleiche Kooperationsbereitschaft wie zwischen den ~Machern.. zeigte sich auch auf der Ebene der Akteure Ein interessante, in sich stimmige Produktion. der man über diese Uraufführung hinaus viel Erfolg - nicht nur in Kassel - prophezeien kann.
Angela Maaßenentsteht ein Summen, erst einstimmig, dann fallen die anderen mit ein, und schließlich singen die Männer im fünfstimmigen Satz ein süddeutsches Wirtshauslied: Wir gehn nicht heim, wir bleiben da.Erster Satz eines Musiktheaterstücks, mit dem der Kasseler Komponist Reinhard Karger nicht lediglich eine Handlung vertont oder musikalisch kommentiert, sondern die Handlung selbst zum Klingen bringt: im Männerchorgesang, im Sprechen, im Lachen, im Schimpfen, im Weinen, im Schweigen. Und zwar in der formalen Gestaltung einer klassischen Komposition mit einer Abfolge von Sätzen: Der Stammtisch wird Musik. Nicht immer so formal streng wie im Scherzo, einem langen An- und Abschwellen von Gelächter, in dem sich die Stimmen zu einem polyrhythmischen Lachstück vereinen.Die fünf Männer werden von Schauspielern und nicht von Sängern verkörpert, denn es handelt sich, wie der Untertitel sagt, um ein Männerkonzert, ein Konzert der Männer und nicht von Musikern. Jeder hat seine Stimme und seine Geschichte: Einer war mal Schlagersänger, lang ists her, dass er Briefe von Bewunderinnen kriegte. Michael Fajgel spielt ihn in dandyhafter Verzweiflung.Ein anderer, jung, langhaarig, (Daniel Schäfer) hat merkwürdige, religiös verbrämte Fantasien über Frauen. Der nächste träumte von einer Theaterkarriere, bevor er als Darsteller in Schulungsfilmen endete, Herwig Lucas verkörpert ihn eindrucksvoll als Virtuosen leerer Worthülsen. Wolfram Mucha ist ein alter Fußballer, der noch immer dem verlorenen Wembley-Endspiel von 1966 nachhängt, in Wahrheit aber einer verlorenen Liebe nachtrauert. Und schließlich Peter Anger als ehemaliger Lehrer, der von peinlichen Erinnerungen an sexuelle Verfehlungen mit einer Schülerin geplagt wird.
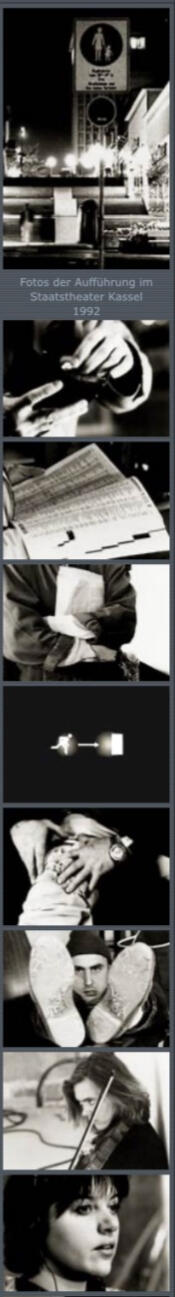
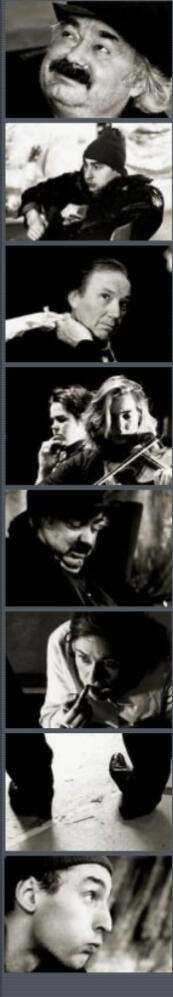
Texte
attention: texts are displayed in German only!
Mein Handy spielt Beethoven Oder: wie dem Komponisten die Zeit
Antrittsvorlesung,
gehalten am 10. Mai 2006 in der Universität Kassel.
stop telling stories!
Zur Entwicklung nicht-narrativer Strukturen im deutschsprachigen Musiktheater – ein Rückblick auf das 20ste Jahrhundert2001, erschienen im Kunstmagazin "Artes", Stockholm
Die Ekstase der Langsamkeit oder
Die Jungfer der Baronin Putbus
Versuch eines Musikers über Marcel Proust1997
DER KOMPONIST
– ein Fossil im Medienzeitalter1988
Texte
Mein Handy spielt Beethoven Oder: wie dem Komponisten die Zeit
Antrittsvorlesung,
gehalten am 10. Mai 2006 in der Universität Kassel.
stop telling stories!
Zur Entwicklung nicht-narrativer Strukturen im deutschsprachigen Musiktheater – ein Rückblick auf das 20ste Jahrhundert2001, erschienen im Kunstmagazin "Artes", Stockholm
Die Ekstase der Langsamkeit oder
Die Jungfer der Baronin Putbus
Versuch eines Musikers über Marcel Proust1997
DER KOMPONIST
– ein Fossil im Medienzeitalter1988
Mein Handy spielt Beethoven
Oder: wie dem Komponisten die Zeit vergeht
Antrittsvorlesung von Prof. Reinhard Karger,
gehalten am 10. Mai 2006 in der Universität KasselMeine Damen und Herren, ich möchte heute darüber sprechen, wie in der Musik die Zeit vergeht – wie sie zur Zeit Ludwig van Beethovens verging und wie sie heute, in einer Zeit der permanenten Präsenz von Musik aus allen Zeiten und an fast allen Orten, vergeht. Diese thematische Setzung führt direkt ins Zentrum jeder kompositorischen Arbeit, ins Problem der musikalischen Form, in die Frage, der sich die Komponisten aller Zeiten täglich stellen mussten und müssen: wie fange ich an und wie finde ich ein Ende.Hätten wir vor 200 Jahren gelebt, wären Anfang und Ende von erklingender Musik noch mit unserem Hören synchronisiert gewesen: Musikalisches Erleben wäre nur möglich gewesen, wenn wir im Vorgang des Zuhörens einen kleinen Teil unserer Lebenszeit mit der vom Komponisten gestalteten und von den Interpreten gefüllten Zeit in Beziehung gesetzt hätten, wenn wir uns ihrem Vorschlag, die Zeit verstreichen zu lassen, ausgesetzt hätten. Und zwischen dem letzten Ton und dem Beginn des nächsten Konzerterlebnisses hätte eine lange musik-lose Zeit gelegen. Das ist heute eher der Ausnahmefall, denn durch die Möglichkeiten der technischen Reproduktion – erst das Tonband, dann die Schallplatte, schließlich die digitale Datenspeicherung – können wir ein Stück nochmals hören, vor- und zurückspringen und beliebig an- und ausschalten, die Gestaltung der musikalischen Erlebniszeit kann – wenn wir das wünschen – asynchron zum Vorschlag des Komponisten verlaufen, und wenn mein Handy „Für Elise“ spielt, hat mir der Produzent des Klingeltons die Zerstückelung der musikalischen Erlebniszeit schon abgenommen, indem er den Atem der klassischen Formgestaltung auf ein zeichenhaftes, beliebig oft wiederholbares Soundlogo reduziert. Wie wirken sich diese veränderten Rahmenbedingungen auf unsere Wahrnehmung von musikalisch gestalteter Zeit aus und wie können Komponisten angemessen auf die sich beschleunigenden Zeitraster unserer Alltagswelt reagieren, wenn sie ihrem Anspruch, Zeitgenossen zu sein, gerecht werden wollen? Mit diesen Fragen wollen wir die uns heute zur Verfügung stehende Zeit gemeinsam verbringen.Kapitel 1: Der erste AvantgardistWir hören zu Beginn das Thema des 2. Satzes der Klaviersonate op. 111, der letzten von Beethoven vollendeten Komposition für Klavier.Ein schlichtes, bescheidenes, in unschuldigem C-Dur daherkommendes Thema, in braven achttaktigen Perioden organisiert und im zweiten Teil in die Parallel-Molltonart modulierend wie es die klassische Konvention nahe legt. Zwei Dinge nur weisen darauf hin, dass es bei dieser abgezirkelten Schlichtheit wohl nicht bleiben wird: die etwas ungewöhnliche Notation im 9/16-Takt und die Tatsache, dass die linke Hand eigentlich eine Oktave zu tief angesiedelt ist – zwischen Ober- und Unterstimmen klafft ein Loch, das nicht aus dem Thema selbst erklärbar ist und sich erst im weiteren Verlauf der Komposition als bewusst gesetzter Rahmen, der durch die folgenden Variationen ausgefüllt wird, zu erkennen gibt.Die physikalische, kontinuierlich verstreichende Zeit ist hier – wie in aller klassischen Musik – gequantelt, sie wird mit den Mitteln der melodischen Bogenbildung, der Kadenzharmonik und der regelmäßigen Periodik in klar unterschiedene „Objekte“ unterteilt, die wir jeweils als „Jetzt“ empfinden und als fest umrissene Einheiten zueinander in Beziehung setzen können . Es handelt sich also wahrnehmungspsychologisch um eine Transposition von Phänomenen mit zeitlicher Ausdehnung in die Dimension des Raumes – man spricht auch von der „Architektur“ der Musik, und im Vorgang des Musik-Erinnerns schafft es unser Hirn sogar, eine ganze Sinfonie auf einen Augenblick zusammenschrumpfen zu lassen und sie als Objekt im Speicher der Vergangenheit neu zu betrachten: Aus einer halben Stunde musikalischer Dauer ist ein Erinnerungs-Moment ohne zeitliche Ausdehnung geworden.Doch wie weit ist unser kleines, zärtliches Thema vom gängigen Beethoven-Bild entfernt! Beethoven, der Willensmensch, der große Protagonist des erwachenden bürgerlichen Ichs, der Schmerzensmann, der sich durch Nacht zum Licht erhebt und schließlich trotz aller Widrigkeiten als strahlender Neuerer die Welt beglückt: So haben ihn die Größen des Dritten Reiches gesehen und zur urdeutschen Figur stilisiert, und in dieser Rolle wird er auch von unseren heutigen Großunternehmen vereinnahmt, wenn sein Bild auf den Scheckkarten oder seine Melodien in den Handys platziert werden. Wer etwas genauer hinschaut, merkt sofort, dass dieses einseitige Bild nicht zu halten ist, dass Beethovens lyrische, ja zärtliche Seite die Kraftmeierei bei weitem überwiegt und dass er vor allem auch ein intellektueller Komponist war, dessen analytische Schärfe und strukturelle Genauigkeit ihn zu einem der wichtigsten Vordenker der Musik des 20sten Jahrhunderts, ja im Grunde zum ersten Avantgardisten im modernen Sinne überhaupt machen – und trotzdem prägt dieses Etikett des „titanischen Genies“ bis heute weitgehend die Wahrnehmung dessen, was man sich unter einem Komponisten vorzustellen habe.
Thomas Mann hat diesem Typus in seinem Roman „Doktor Faustus“ ein Denkmal gesetzt und ihn gleichzeitig ins 20ste Jahrhundert fortgeschrieben: sein Protagonist Adrian Leverkühn will und soll eine neue Musik erfinden, aber – Thomas Mann hat immer den Schalk im Nacken – das kann ihm nur mit Hilfe eines Teufelspaktes gelingen. Wohlwollend beobachtet und fördert der Teufel den Verfall des alten tonalen Systems, denn Zerstörung ist sein Geschäft; er verschafft Adrian eine schleichende Hirnhautentzündung, denn nur ein kranker Künstler ist ein großer Künstler und er treibt ihn bis an seine geistigen und physischen Grenzen, auf dass er eine wahrhaft neue und große Musik erschaffe – der Teufel verspricht ihm eine zeitlich begrenzte, aber grandiose und heroische Komponistenkarriere, wenn im Gegenzug seine Seele bei seinem Tode ihm gehöre. Erlauben Sie mir, aus der entscheidenden Begegnung Adrians mit dem Teufel einen kurzen Abschnitt zu zitieren."Adrian fragt den Teufel: So wollt Ihr mir Zeit verkaufen?
Und der Teufel antwortet: Zeit? Bloß so Zeit? Nein, mein Guter, das ist keine Teufelsware. Dafür verdienten wir nicht den Preis, dass das Ende uns gehöre. Was für ne Sorte Zeit, darauf kommts an! Große Zeit, tolle Zeit, ganz verteufelte Zeit, in der es hoch und überhoch hergeht, – und auch wieder ein bisschen miserabel natürlich, sogar tief miserabel, das gebe ich nicht nur zu, ich betone es sogar mit Stolz, denn so ist es ja recht und billig, so ists doch Künstlerart und –natur. Die, bekanntlich, neigt allezeit zur Ausgelassenheit nach beiden Seiten, ist ganz normalerweise ein bisschen ausschreitend. Da schlägt immer das Pendel weit hin und her zwischen Aufgeräumtheit und Melancolia, das ist gewöhnlich, ist sozusagen noch bürgerlich-mäßiger, nürrembergischer Art im Vergleich mit dem, was wir liefern. Denn wir liefern das Äußerste in dieser Richtung: Aufschwünge liefern wir und Erleuchtungen, Erfahrungen von Enthobenheit und Entfesselung, von Freiheit, Sicherheit, Leichtigkeit, Macht- und Triumphgefühl, dass unser Mann seinen Sinnen nicht traut, – eingerechnet noch obendrein die kolossale Bewunderung für das Gemachte, die ihn sogar auf jede fremde, äußere leicht könnte verzichten lassen, – die Schauer der Selbstverehrung, ja des köstlichen Grauens vor sich selbst, unter denen er sich wie ein begnadetes Mundstück, wie ein göttliches Untier erscheint."Mit der ihm eigenen spöttischen Ironie lässt Thomas Mann den Teufel das Bild des Künstlergenies ausmalen, dem eine begrenzte Lebenszeit zugestanden wird, um unsterblich zu werden, die Vorstellung von Größe ist hier also untrennbar an die Vergänglichkeit gekoppelt, und obendrein geht es nicht mit rechten Dingen zu, es ist Teufelswerk.
In „Doktor Faustus“ meinte Mann nicht Beethoven, sondern Arnold Schönberg, denn es geht um Zwölftonmusik, und seine Einsicht in musiktheoretische Details verdankt er Theodor W. Adorno, von dem er sich intensiv beraten ließ, aber diese Fortschreibung und Zuspitzung der Genieproblematik ins 20ste Jahrhundert bezieht sich ohne Zweifel auf das Komponistenbild, das zuallererst durch das Auftreten Beethovens in der Musikgeschichte geprägt wurde.Hören wir jetzt die erste Variation unseres kleinen Themas von vorhin.Schon in der 1. Variation bläst der Wind der Veränderung kräftig in das kleine Thema hinein: Harmonische Ausweichungen, vielfache Vorhaltsbildungen und die Aufsplitterung in einen 16tel-Puls – erst jetzt macht der 9/16-Takt so richtig Sinn – strapazieren es bis an die Grenze der Wiedererkennbarkeit, nur das zeitliche Gehäuse – die regelmäßigen 8taktigen Perioden – bleibt erhalten; der kompositorische Gestaltungseros wirbelt sozusagen das ganze Mobiliar durcheinander, aber das Haus bleibt stehen, es wird –vorerst – nicht gesprengt, und die Veränderungen wirken nur deshalb so kühn, weil sie auf die vorgegebene Zeitquantelung bezogen bleiben.Hier zeigt sich Beethovens Modernität: Der Komponist gibt sich nicht damit zufrieden, bestehende konventionelle Modelle der Zeitgestaltung wie die barocke Tanzsuite oder die Sonatenhauptsatzform mit neuem Inhalt zu füllen, sondern er besteht darauf, die Modelle selbst zum Thema der Arbeit zu machen, sie zu zerstören und neu zu formieren, jeder Komposition eine eigene, unverwechselbare Form in der Zeit zu geben, die es möglich macht, eine individuelle, einzigartige Geschichte zu erzählen, die vorher noch niemand erzählt hat und die auch später nicht mehr erfunden werden kann: die klassische Definition von Zeitgenossenschaft. In jeder kompositorischen Bewegung steckt ein Stück Utopie: So wie die Musik ist, kann sie nicht bleiben, sie muss origineller, interessanter, emotionaler werden, um dem neuen bürgerlichen Menschen, der sich den Idealen der französischen Revolution verpflichtet fühlt, gerecht zu werden. Hier bildet sich der Typus des Komponisten als „Zeit-Erfinder“, er ist der Demiurg, der Schöpfer eines neuen Vorschlags, wie die Zeit vergehen könnte – und er ist dadurch natürlich immer auch ein Missionar, ein ästhetischer Vor-Denker, der darauf angewiesen ist, dass das Publikum seine neuen Ideen hörend nachvollzieht. Bis in unsere Tage ist dieses Bild vom Komponisten als Künder des Zukünftigen, der in seiner einsamen Arbeit den Vorschein einer besseren Gesellschaft oder zumindest die un-erhörten Regionen einer Musik der Zukunft erforscht, wirksam, und noch vor wenigen Jahrzehnten hat Theodor W. Adorno es uns in seiner „Philosophie der neuen Musik“ ja noch einmal deutlich und virtuos vor Augen geführt.Kapitel 2: Die offene FormDer Name Adorno deutet es schon an: Wir machen einen Sprung ins 20ste Jahrhundert, in die bundesrepublikanische Nachkriegszeit. Der klassische beethovensche Impuls war im mitteleuropäischen Komponieren vielfach aufgenommen und verwandelt worden, und im deutschsprachigen Raum fühlte man sich vorwiegend der Traditionslinie Schubert – Brahms – Wagner – Schönberg – Webern verpflichtet und versuchte, im Niemandsland nach der Katastrophe des 2. Weltkriegs Orientierung zu finden – entweder durch Wiederaufnahme von Fäden aus der Vorkriegszeit (so z. B. die Weiterentwicklung der Schönbergschen Zwölftonmethode zum System der seriellen Musik), oder durch die Postulierung von ganz neuen ästhetischen Konzepten (wie die durch den Amerikaner John Cage angestoßene Diskussion über die Auflösung des traditionellen Werk-Begriffes und das radikale Postulat, alles, was klinge, könne möglicherweise Musik sein). Die klassische Tradition im Gewand des konservativen bürgerlichen Konzertbetriebs der 50er- und 60er-Jahre wurde vielfach als erstarrte, konventionelle Hülse wahrgenommen, und aus dieser Zeit stammt auch der berühmte Ausspruch von Pierre Boulez, man solle am besten alle Opernhäuser in die Luft sprengen. Wie haben sich die Komponisten – angesichts dieses Szenarios – mit dem Thema Zeit auseinandergesetzt? Es gab viele interessante Ideen, ich möchte mich jedoch auf die exemplarische Darstellung der beiden sehr unterschiedlichen Ansätze von Karlheinz Stockhausen und Morton Feldman beschränken, nicht zuletzt deshalb, weil beide meiner Vätergeneration angehören und meinen eigenen Weg maßgeblich beeinflusst haben. Was den Umgang mit musikalischer Zeit betrifft, so sind beide – der deutsche wie der amerikanische Komponist – auf sehr verschiedenen Wegen und teilweise in direkter Konkurrenz ihrer konträren Positionen schließlich doch zu ähnlichen Ergebnissen gelangt.Stockhausen hat in den 50er- und 60er-Jahren einige Texte verfasst, die die Entwicklung der seriellen Musik enorm beeinflusst haben – unter anderem den Aufsatz „…wie die Zeit vergeht…“ von 1956, der Pate gestanden hat für die Formulierung des Untertitels meiner heutigen Vorlesung, und den Radio-Text „Momentform“ von 1960, aus dem ich Ihnen zwei Abschnitte zitieren möchte.Stockhausen formuliert, der neue Begriff einer so genannten „offenen Form“ sei dann erfüllt, "… wenn eine Komposition keine durchlaufende Geschichte erzählt, nicht an einem „roten Faden“ entlang komponiert st, den man von Anfang bis Ende mitverfolgen muss, um das Ganze zu verstehen – wenn also keine dramatische Form mit Exposition, Steigerung, Durchführung, Höhepunkt- und Finalwirkung vorliegt (keine geschlossene Form), sondern wenn jeder Moment ein mit allen anderen verbundenes Zentrum ist, das für sich bestehen kann."Die klassische Vorstellung, musikalische Zeit zu gestalten, nämlich eine Form in der Zeit kompositorisch zu modellieren, sollte also abgelöst werden von einem Konzept der Gestaltung von Jetzt-Momenten, die in beliebiger Anzahl aneinander gereiht werden konnten, so dass nun nicht der Komponist eine bestimmte, vom Publikum nachzuvollziehende Geschichte erzählen, sondern jeder einzelne Zuhörer sich aus dem Angebot an Klängen seinen je eigenen Hörpfad suchen sollte. Dies ist nebenbei bemerkt eine sehr frühe Formulierung einer Zeitkonzeption, die uns heute in den verschiedensten Realisierungen – als soundscape, environmental art oder chillout zone – wieder entgegentritt.Noch einmal Stockhausen, aus demselben Text:"Ich verbinde mit den Worten Beginn und Schluss die Vorstellung von Zäsuren, die eine Dauer als Ausschnitt aus einem Kontinuum heraus begrenzen. Anfang und Ende eignen demnach geschlossenen Entwicklungsformen, die ich auch dramatische Formen nannte; Beginn und Schluss eignen offenen Momentformen. Deshalb kann ich auch von einer un-endlichen Form sprechen, wenngleich man eine Aufführung in der Dauer nach aufführungspraktischen Gesichtspunkten begrenzt. Der Unterschied von Schluss und Ende wird sofort deutlich, wenn man an Feste denkt, bei denen man Schluss macht, obwohl sie gar nicht zu Ende sind (eine Konvention sagt, man solle Schluss machen, wenn es am schönsten sei); und wenn man umgekehrt sich an die Feste erinnert, die längst zu Ende waren, bevor man Schluss gemacht hat. In dem Sinne ist es folgerichtig, dem Begriff des Unendlichen als Entsprechung den des Unanfänglichen zuzuordnen."Ich denke, es ist deutlich geworden, was Stockhausen vorschwebte: ein im Prinzip unendliches Musikstück, aus dem der emanzipierte Hörer seine Dauer und seine individuellen Höhepunkte selbst heraussucht. Nun entsprang seine Haltung keineswegs einem lockeren laissez-faire, ganz im Gegenteil: Er war ein strenger, selbstbewusster Zuchtmeister der Avantgarde an der Speerspitze der kompositorischen Entwicklung, der sich selbst durchaus als legitimer Nachfolger von Beethoven und Schönberg sah, und dessen ungebrochene Ich-Bezogenheit bis heute eher noch zugenommen hat, denn während sich das Beethovensche Pathos noch damit begnügte, seinen „Kuss der ganzen Welt“ übermitteln zu wollen, versteht sich Stockhausen nun als Weltenschöpfer im kosmischen Maßstab, dessen Arbeit in menschlichen Kategorien nicht mehr zu fassen ist – nein, sowohl die Zerstörung der traditionellen Stilmittel als auch das Weiterspinnen der Fäden aus der Musikgeschichte sind bei ihm gleichermaßen als willensbetonte Kraftakte zu sehen, die das Neue aus einer historischen Berufung heraus schaffen müssen, und insofern steht er trotz aller Erneuerungsbehauptungen deutlich in einer spezifisch deutschen geistesgeschichtlichen Tradition.
Eine polar entgegen gesetzte ästhetische Haltung verkörperte der 1987 verstorbene amerikanische Komponist Morton Feldman: zwar war auch er der Ansicht, man müsse den ganzen Ballast der mitteleuropäischen Tradition mitsamt ihren tragischen Verstrickungen, die schließlich zur Katastrophe des 2. Weltkrieges geführt hätten – Feldman war jüdischer Herkunft – , abschütteln und von Grund auf neu anfangen, seine ästhetische Suchbewegung tendierte jedoch in eine ganz andere Richtung. In seinen Aufzeichnungen ist an einer Stelle in seiner kindlichen Kritzelschrift zu lesen: polyphony sucks, also frei übersetzt „Polyphonie ist Scheiße“. Er wollte nicht – wie Stockhausen – die großen historischen Linien weiterführen, sondern einen ganz neuen, frischen Ansatz wagen und in seinen ästhetischen Fernduellen mit Stockhausen erhob er den – durchaus auch politisch gemeinten – Vorwurf, die europäischen und speziell die deutschen Komponisten würden die Töne durch die Gegend schubsen und in serielle Raster pressen, Töne seien aber wie Lebewesen, mit eigenen Rechten und einer eigenen inneren Zeit ausgestattet, und müssten auch als solche behandelt werden. Feldman war von der Lebensweise der Nomaden fasziniert, und einer seiner stets druckreifen Sprüche lautete: I like nomads, because they just follow the cattle. Sein Kulturpessimismus äußerte sich in der Vorstellung, das Beste was die Menschen tun könnten, wäre, all ihre hehren Projekte aufzugeben und den Tieren zu folgen, die wüssten schon, wie man überleben kann und wo es was zu fressen gibt. Dabei war Feldman alles andere als ein Naturbursche, er war im Gegenteil ein waschechter New Yorker Intellektueller und hätte es wahrscheinlich keine drei Tage bei den Nomaden ausgehalten. Allerdings war er ein begeisterter Sammler von Nomaden-Teppichen, und die Struktur dieser Teppiche hat ihm entscheidende Anregungen für seine kompositorische Arbeit gegeben: Es gibt bei den afrikanischen Nomaden eine Knüpftechnik, die nicht auf die Ränder des Teppichs hin ausgerichtet ist, sondern über sie hinausweist, der „gedachte“ Teppich ist also eigentlich unendlich groß, und der real vorliegende Teppich nur ein relativ beliebiger Ausschnitt aus einem unendlichen Kontinuum. Genau diese formale Konzeption übernimmt Feldman für sein gesamtes Spätwerk: die Stücke sind meist sehr lang, sie fangen irgendwann an und hören irgendwann wieder auf, ohne erkennbare Gestaltung von Anfang und Ende, sie sind immer sehr leise und variieren sehr wenige Grundelemente auf immer neue Weise – es entstehen also eher innerlich reich bewegte Zustände als wie auch immer gestaltete Erzählbögen. Ich selbst verdanke einer Begegnung mit Feldmans zweitem Streichquartett eines meiner eindrücklichsten Konzerterlebnisse überhaupt: Als das Kronos-Quartett das viereinhalbstündige Stück bei den Darmstädter Ferienkursen für neue Musik im Jahre 1984 zur Uraufführung brachte, waren nach einer halben Stunde zwei Drittel der Zuhörer gegangen, das restliche Drittel aber harrte aus bis zum letzten Bogenstrich und war zutiefst berührt von der Zartheit und Melancholie dieser existentiellen, gemeinsam verbrachten Zeitspanne.Feldman hatte über seinem Schreibtisch zur steten Erinnerung einen Notizzettel hängen, auf dem stand: stop telling stories! Hör auf, Geschichten zu erzählen! – stimmiger und prägnanter lässt sich seine ästhetische Provokation nicht zusammenfassen. Und er bestand darauf, die eigentliche Arbeit des Komponisten sei, einsam zu bleiben, Lebenszeit mit den Klängen zu verbringen und sich nicht ablenken zu lassen, und auf die Frage nach seinem kompositorischen Geheimnis antwortete er: I dont leave the house, thats all.Zwei diametral entgegen gesetzte Musikerpersönlichkeiten: hier der Typus des wachen deutschen Forschers, der das Material sichtet, ordnet und neu zusammensetzt und der durch das Licht seines Geistes die Zukunft erhellt – und dort der unablässig horchende, spürende Sucher, der mit seinen Klängen lebt wie mit Pflanzen oder mit Haustieren, der nicht agiert, sondern reagiert und dessen Reich die Dämmerung ist, das Zwielicht des Zweifels und des Tastens. Und obwohl der Deutsche und der Amerikaner aus völlig verschiedenen Geisteswelten kommen und ihre Stücke tatsächlich sehr unterschiedlich klingen, sind ihre Zeitkonzeptionen doch erstaunlich ähnlich, so dass sich der Eindruck aufdrängt, hier sei – unabhängig von den konkreten Personen – etwas „Historisch Notwendiges“ passiert.Und in der Tat hatten diese Vorgänge innerhalb der Welt der Musik auch eine gesellschaftliche Dimension: Im kulturellen Vakuum der Nachkriegszeit entstand allmählich das Bild eines neuen, emanzipierten Menschen, der allem vorformulierten Pathos misstraut und selbstbestimmt – in der Politik wie in der Musik – über seine Zeit und seine Inhalte verfügt, der sich politisch nicht verführen lässt und selbst entscheidet, wann er in einem Konzert erscheint und wann er wieder geht – es war auch ein demokratischer Impuls, und in der Zeit um 1968 haben sich die Protagonisten dieses neuen Menschenbildes ja auch ausführlich an der gesellschaftlichen Wirklichkeit gerieben.Viele andere Komponisten haben diese Entwicklung mit vorangetrieben und die Impulse auf ihre Weise aufgenommen – erwähnt seien John Cages Hinwendung zum Zen-Buddhismus, der die musikalische Zeit in der Lebenszeit aufhebt, die Anprangerung von Unterdrückung und Folter in den Musiktheaterwerken von Luigi Nono, Helmut Lachenmanns permanente Arbeit im und gegen den verkrusteten bürgerlichen ästhetischen Apparat und die Konzeption einer „Kugelgestalt der Zeit“ des Kölner Komponisten B.A. Zimmermann, der postulierte, dass in einer Zeit der technischen Reproduzierbarkeit von Musik der Komponist quasi im Mittelpunkt einer Kugel stünde, von dem alle Musikstile und alle historischen Schichten gleich weit entfernt seien, sodass heute in einer Komposition Gesualdo, Hochromantik und Jazz sich nicht ausschließen müssten, sondern durchaus als Impulsgeber koexistieren könnten. Flapsiger formulierte es der Komponist Heiner Goebbels, der vor wenigen Jahren sagte: "Die Musikgeschichte ist ein Supermarkt, wir können uns bedienen."Kehren wir zurück zu Beethoven. Wir überspringen die 2. und 3. Variation, die unserem kleinen Thema weitere Zersplitterung, Beschleunigung und rhythmische Bockssprünge zumuten und wenden uns der 4. Variation zu: Hören Sie, wie sich das Motiv immer mehr von seinen Wurzeln entfernt, wie es sich in einen unbekannten Klangraum vortastet und nach und nach alle Fesseln der Konvention ablegt – fast verzweifelt klammert es sich noch lange an das Gerüst der 8taktigen Periode, bis es schließlich auch dieses verlässt um in einer Wolke von Trillerkaskaden, die eher der Welt von György Ligeti als der von Ludwig van Beethoven anzugehören scheinen, zu verschwinden.4. Variation des ThemasDer dreifache Triller, den wir soeben gehört haben, ist einzigartig in der klassischen Klavierliteratur, und Beethoven steuert hier – am Ende seines künstlerischen Weges – eine Kategorie an, die eigentlich erst im 20sten Jahrhundert als kompositorisch zu gestaltende ihre Blütezeit erlebte: die Klang- und Klangfarbenkomposition. Sowohl die Forschungen von Debussy, Schostakowitsch und Schönberg als auch die frühen Versuche der elektronischen Musik oder die statischen, in sich bewegten Klanggebilde von Ligeti lassen sich mit dieser frühen Vision von Beethoven zusammendenken, die die Auflösung der klassischen, sprachähnlichen Quantelung der musikalischen Zeit in Bögen, Perioden und Formteile vorwegnimmt und eine „Nullzeit“ postuliert, die erst durch das Ohr, den Erfahrungshintergrund und die Ausdauer des Zuhörers zu einer individuell verstreichenden Zeit ausformuliert wird.Kapitel 3: Vom Altern der Neuen MusikDiese Denkfigur, die permanente Verfügbarkeit und individuelle Wahlmöglichkeit postuliert und die Verantwortung für das Verstreichen der Zeit abgeben will, ist nicht nur in der Welt der Musik, sondern parallel in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen aufgetaucht – denken Sie nur an den alten Traum von der „ewigen Jugend“, der durch die Klonphantasien der Biotechniker zu neuer Blüte gelangt ist, an die Idee der vollständigen Entkoppelung von Sexualität und Nachkommenschaft durch die in Amerika bereits real bestehende Möglichkeit, Kinder durch Leihmütter austragen zu lassen und den Zeitpunkt der Geburt und die Eigenschaften des Kindes – durch Wahl eines Samenspenders mit den gewünschten Eigenschaften – frei zu bestimmen, an das Angebot, sich bei lebendigem Leibe einfrieren zu lassen, um in 200 Jahren in einer – hoffentlich besseren – Gesellschaft wieder aufgetaut zu werden, denken Sie an den politischen Traum vom „Ende der Geschichte“, der nach dem Exitus der Sowjetunion und dem Abebben des kalten Krieges eine befriedete Welt erhoffte, in der die Konflikte vernünftig und ausschließlich mit diplomatischen Mitteln gelöst würden – kurz an die Vorstellung eines radikalen Paradigmenwechsels in einer „post-histoire“, die die Menschen nicht mehr in ein gemeinsames Schicksal zwingt und die Verfügungsgewalt über die eigene Lebenszeit auf das Individuum überträgt.Was ist der Kern dieser Denkfigur, wo steckt ihr Motiv? Psychologisch gesprochen ist den genannten Beispielen gemeinsam eine Angst vor dem Ende des Atems, Angst vor dem Altern, Angst vor dem Tod, ein Aufbegehren gegen die Vergänglichkeit und die Endgültigkeit und Nicht-Korrigierbarkeit unserer Entscheidungen.Auch in der Welt der Musik gab es dieses Pathos des Aufbruchs in eine „schöne neue Welt“ der unbegrenzten Möglichkeiten – am besten lässt sich das anhand der kurzen Geschichte der elektronischen Musik veranschaulichen: Nach dem zweiten Weltkrieg herrschte in den neu entstehenden elektronischen Studios in Köln, Stockholm, Utrecht und Paris eine euphorische Aufbruchsstimmung: man machte sich auf ins exotische Neuland der elektronisch erzeugten Klänge, im Prinzip schien es nun möglich, jeden beliebigen Klang künstlich zu erzeugen, es sollte eine neue moderne Musik entstehen, die nicht mehr von den traditionellen Klangerzeugern abhängig war und die ihre ganz eigenen Kompositionsmethoden und ihre eigene Ästhetik entwickeln sollte. Heute ist diese elektronische Musik – bis auf wenige Ausnahmen – vollständig aus den Konzertsälen verschwunden, sie hat sich nicht durchgesetzt und ist nur noch von historischem Interesse. Ich habe mir die Frage, woran das wohl liegen mag, selbst oft gestellt, denn ich wurde als junger Student in den 70er-Jahren genauso von dieser Forscher-Euphorie erfasst und beschäftige mich heute, wo die technische Entwicklung der Geräte die Erfüllung fast aller Träume von damals möglich macht, kaum mehr mit diesem Gebiet.Elektronische Klänge haben von sich aus keine zeitliche Gestalt, keinen Atembogen, sie werden eingeschaltet und klingen so lange, bis sie wieder ausgeschaltet werden. Es scheint so zu sein, dass diese Eliminierung des Verklingens, diese prinzipielle Unendlichkeit den ästhetischen Ansprüchen der meisten Komponisten zuwiderläuft, dass sie sich nicht genug herausgefordert fühlen von dem neuen Medium. Dennoch hat die elektronische Musik enorme Bedeutung erlangt – sie ist in die Popmusik ausgewandert: Ins rauschhafte Reich des Techno, in die Privatkosmen der Laptop-Tüftler und in die akustische Schleimspur der Synthesizer-Klangflächen in den Hitparaden.Und sie prüft täglich unsere Geduld in ihren vielfältigen Erscheinungsformen im modernen Alltag: Wir kennen alle die piepsigen Wecktöne, die Alarmanlagen und die
ungerufen in unser Ohr dringenden Handy-Klingeltöne, die sich gerne humanistisch gebildet geben, indem sie die Themenköpfe aus den „Highlights“ der klassischen Musik zitieren, aber deren ursprünglichen Sinn – nämlich ihre Entwicklung und Veränderung in der Zeit – ignorieren. Und wenn mein Handy Beethoven spielt, dann transformiert sich die ans Endliche des Atems gebundene Beethovensche Konzeption in die Welt der unendlichen Verfügbarkeit, und wenn ich nicht drangehe, dann wird mein Handy ewig weiterklingeln, abhängig allein von den Ressourcen der Stromversorgung und nicht mehr an ästhetische Kriterien gebunden.Diese Denkfigur, die die Vergänglichkeit und Unwiederbringlichkeit des musikalischen Ereignisses in der Zeit aufheben will zugunsten der permanenten Verfügbarkeit eines bestimmten Klangvorrates, oder – auf der Ebene der Musikkultur insgesamt – eines weißen Rauschens, das sich aus allen jemals erzeugten Klängen zusammensetzt, und aus dem jeder Einzelne sich sein eigenes Musikstück herausfiltert (oder digital gesprochen: downloadet) – dieser durchaus demokratische, aufklärerische Impuls hat eben auch eine dunkle, chaotische Seite, die heute, einige Jahrzehnte nach der Formulierung der Konzeption, immer deutlicher sichtbar wird.Nicht nur in der elektronischen Szene, sondern auch in der neuen Instrumentalmusik ist die Hilflosigkeit im Umgang mit der Zeit-Kategorie oft unüberhörbar: die ursprünglich kraftvollen, revolutionären Regeln der Pioniere – neben der Auflösung der klassischen Zeitkonzeption das Konsonanzverbot, das Tonwiederholungsverbot, die Erweiterung des Klangbildes in die extremen Lagen, die Zersplitterung der Sprache und der musikalischen Phrase – wurden durch ständige Wiederholung zum Klischee, der Gestus des „Aufbruchs in unerhörte Regionen“ wurde zum neuen Gesetz und hat sich so mit der Zeit selbst ad absurdum geführt, er hat die Rolle eines Etikettes angenommen („aha, neue Musik“), unter dem sich leicht dürftige Substanz und mangelnde Phantasie verbergen lassen. Die Frische der ehemals neuen ästhetischen Setzungen wird nur noch verwaltet und in der Schublade „Avantgarde“ abgelegt, aus der man sich bei Bedarf bedienen kann. Es gibt immer mehr hervorragende Musiker, die neue Kompositionen überzeugend präsentieren können – wie sehr haben wir Komponisten uns vor 20 Jahren eine solche Leistungsdichte gewünscht! –, aber oft bleibt man als Hörer auf den einschlägigen Festivals distanziert und gelangweilt angesichts dieser verwalteten Perfektion, und man sehnt sich nach einer unvollkommenen Schüleraufführung, wo etwas neu aufbricht, wo eine Schwelle überschritten wird und ein gültiger, nicht zu wiederholender Augenblick sich ereignet.Meine These ist: die Neue Musik ist alt geworden, weil sie nicht gelernt hat, zu altern, weil sie nach 50 Jahren noch immer in den Kinderschuhen steckt und die Konzeptionen aus den frühen heroischen Tagen festhält, weil sie sich aus der Verantwortung für die Zeit gestohlen hat und sich die Freiheit nimmt, provisorisch nur zu spielen in einem im Prinzip unbegrenzten, geschützten Raum, wo nichts wirklich gilt und alles im Prinzip wieder gelöscht und neu angefangen werden kann. Zugegeben: Das ist polemisch und sehr pauschal formuliert und beschreibt natürlich keinesfalls die komplexe Szenerie der neuen Musik als Ganze, aber vielleicht kann eine solche Polemik Anstoß sein, das Bewusstsein und die Sinne zu schärfen für die Fragen, an denen sich die Qualität und die Zeitgenossenschaft einer Komposition heute entscheidet.
Kapitel 4:
Beethovens Zukunft
oder: Kleines Lob der VergänglichkeitWie vergeht den Komponisten heute die Zeit, wie können sie angemessen reagieren auf diese fundamentalen Umwälzungen im musikalischen Produktions- und Wahrnehmungsfeld? Macht es überhaupt noch einen Sinn, Beethovens Streben nach Originalität und Individualität in die Zukunft weiterzutragen oder wird dieses Modell im allgemeinen Rauschen der permanent verfügbaren Clips versinken? Will sich die Gesellschaft den professionellen Komponisten, den Forscher im Reich der Schwingungen und ihrer Wahrnehmung, überhaupt noch leisten, oder liegt die Zukunft eher bei den neuen „Eingeborenen des Internet“, die mit großem Energie- und Zeitaufwand und ohne professionelle Ausbildung ihre tracks und clips produzieren und in großen, weltweiten Tauschbörsen einen ganz anderen ästhetischen Diskurs führen? Erleben wir eine Renaissance der oralen Tradition – nun im digitalen Gewand – und eine hedonistische Parodie der Parole von Joseph Beuys, jeder Mensch sei ein Künstler?Wir wissen es nicht. – aber wir wundern uns doch, wie schnell wir von Avantgardisten zu konservativen Widerständlern mutiert sind, weil wir nicht auf die überlieferten ästhetischen Kategorien unserer Tradition verzichten wollen.Eine Strategie, die bewusste Gestaltung der musikalischen Zeit auch im Zeitalter der Reizüberflutung weiterzuverfolgen, ist, den Spieß umzudrehen, nicht „Klang“ in die Stille zu setzen, sondern „Stille“ selbst zum Thema der kompositorischen Arbeit zu machen. Viele heutige Komponisten beschäftigen sich mit den Vorgängen des Verschwindens, des Verstummens, des Aushauchens, um in der Musik Wege in einen Zustand der aktiven Kontemplation, der Sammlung in der Stille zu finden, einen Zustand, der aus unserem Alltag mehr und mehr verschwindet, – viele Kompositionen, z. B. von Cage, Feldman, Kurtag, Scelsi oder Nono geben Zeugnis von diesem Versuch. Aber auch diese Umkehrung ist historisch gebunden und kann nicht festgehalten werden, auch das Suchen nach Stille kann zum Manierismus degenerieren – und so sehen wir uns vor jedem neuen leeren Notenblatt in eine große Unwissenheit hineingeworfen, wir sind permanente Anfänger, die vorsichtig tastend und für jedes Stück neu versuchen müssen, ästhetische Stimmigkeit zu erreichen, was gleichbedeutend ist mit: unsere Gegenwart wahrhaftig zu spiegeln.Es scheint so zu sein, dass wir heutigen Komponisten die Vorstellung eines „befreiten, selbstbestimmten“ Hörens in einem permanent präsenten „Meer von Klang“ aufgeben müssen, dass wir zum Geschichtenerzählen verdammt sind, dass wir einen Anfang und ein Ende brauchen – dass wir uns also nicht aus der Verantwortung für die von uns zu gestaltende Zeit stehlen können. Um unserem Anspruch an Zeitgenossenschaft gerecht zu werden, um unsere eigenen, aktuellen Geschichten zu erzählen, können wir natürlich nicht einfach auf die überlieferten musiksprachlichen Elemente zurückgreifen, weder auf die von Beethoven, noch auf die von Mahler, Schönberg oder Lachenmann – wir sind verdammt, im Dunkeln zu stochern und für jedes Stück unser Repertoire an Gestaltungsmöglichkeiten neu zu überprüfen. Wie die Zeit eines Werkes vergeht, muss in jedem einzelnen Fall neu erforscht werden, nur das ständige Befragen der schon etablierten Denkfiguren und eine wache Formphantasie können den Geist des jeweiligen historischen Momentes in einem musikalischen Werk einfangen und wirksam werden lassen.Diese ästhetische Forscherarbeit muss aber durchdrungen sein vom Bewusstsein der Flüchtigkeit unseres Tuns, denn ohne ein Bekenntnis zum Ende, also letztlich zu unserer Sterblichkeit, verflüchtigen sich die Wahrheit und auch – um einen abgegriffenen Begriff zu benutzen – die Schönheit in der Kunst. Und hier schließt sich der Kreis: Wir sind nicht klüger als Beethoven, wir stehen – wenn auch in sehr anderer Landschaft – genauso bang und unsicher vor jeder neuen Aufgabe und sind aufgerufen, dem Chamäleon „Zeit“ immer neu zu begegnen. Und die Radikalität und Konsequenz, mit der Beethoven diesen Weg gegangen ist, kann auch uns Heutigen als Vorbild dienen, auch wenn wir uns sicher vom Bild des titanischen Welterlösers trennen und uns wieder mehr als Handwerker verstehen müssen, die bescheidener und in konkreten kulturellen Zusammenhängen ihre Arbeit tun.Erlauben Sie mir, mein kleines Lob der Vergänglichkeit noch durch ein literarisches Beispiel anschaulich zu machen – es stammt von einem meiner Lieblingsschriftsteller, der vor nunmehr fast hundert Jahren dieses Loblied virtuos wie kein Anderer gesungen hat: von Marcel Proust, dessen großer Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ mich schon seit vielen Jahren begleitet.An einer Stelle fährt der Ich-Erzähler mit dem Zug durch eine ländliche französische Gegend, es ist Abend, er schaut versonnen aus dem Fenster. Plötzlich hält der Zug auf offener Strecke am Rande eines Wäldchens an und bleibt über eine halbe Stunde dort stehen. Der Fahrgast langweilt sich, er schaut auf das Wäldchen, kann aber nichts Bemerkenswertes erkennen. Irgendwann hört er von ferne das Geräusch von Eisenhämmern, die auf die Schienen schlagen, offenbar müssen sie repariert werden, damit der Zug weiterfahren kann, was er schließlich auch tut. – Szenenwechsel – Einige Jahrzehnte (und einige tausend Seiten) später befindet sich der Ich-Erzähler auf einer mondänen Party und bekommt gerade eine Tasse Tee serviert. Der Diener ist etwas unachtsam, und so schlägt der Teelöffel einige Male an die Untertasse – und plötzlich schießt in ihm die Erinnerung an jene Szene im Zug hoch: die akustische Ähnlichkeit des Teelöffel-Geräusches mit den aus der Ferne klingenden Eisenhämmern von damals schlägt die Brücke, und das Bild steigt noch einmal – nun aber verwandelt – in ihm empor: die melancholische Abendstimmung, die warme Sonne, das kleine Wäldchen – wie schön und poetisch war dieser Augenblick und wie konnte ich ihn damals verpassen und gelangweilt darauf warten, dass der Zug weiterfuhr! Erst jetzt, wo das ursprüngliche Erlebnis unwiederbringlich in der Vergangenheit versunken ist, wird es kostbar und schön, erst jetzt, wo die Zeit durch das Ineinanderfallen von Gegenwart und sehnsüchtiger Erinnerung für einen Moment aufgehoben ist, erwacht es zu wirklichem Leben.Dies ist eine Schlüsselszene nicht nur für Prousts Denken über die alltägliche Wahrnehmung, sondern auch für seine Kunsttheorie: das Kunstwerk steht nie für sich allein und wirkt bloß nach außen – es muss immer ein Stück Erinnerung aus der Lebenswirklichkeit des Betrachters oder Zuhörers mitwirken, das früher Erlebte verbindet sich mit dem aktuellen ästhetischen Eindruck, Vergangenheit und Gegenwart werden eins, man befindet sich für einen kurzen Augenblick außerhalb der Zeit – nur so kann uns Kunst ins Leben und ans Herz wachsen und genau das meinen wir in einem tieferen Sinne, wenn wir von einem „zeit-losen“ Kunstwerk sprechen. Ich fühle mich dieser Kunsttheorie sehr nahe, und so schließe ich mich Hanns Eisler, dem Schönberg-Schüler und großen Marxisten unter den Komponisten, an, der vor 70 Jahren seinen Schülern zurief: Lesen Sie Proust!Zum Schluss müssen wir noch einmal zurück zu Dr. Faustus: Der Teufel gibt Adrian Leverkühn ein deftiges memento mori mit auf den Weg indem er ihm zu verstehen gibt, dass es in ihrem Disput keineswegs nur um die musikalische, sondern ebenso um seine Lebens-Zeit geht, die durch seinen Tod begrenzt sein wird, er sagt zu ihm:"Es hat Zeit damit, reichliche, unabsehbare Zeit, – Zeit ist das Beste und Eigentliche, das wir geben, und unsere Gabe das Stundglas, – ist ja so fein, die Enge, durch die der rote Sand rinnt, so haardünn sein Gerinnsel, nimmt für das Auge gar nicht ab im oberen Hohlraum, nur ganz zuletzt, da scheints schnell zu gehen und schnell gegangen zu sein, – aber das ist so lange hin, bei der Enge, dass es der Rede und des Darandenkens nicht wert ist. Nur eben dass das Stundglas gestellt ist, der Sand immerhin zu rinnen begonnen hat, darüber wollt ich mich gern mit dir, mein Lieber, verständigen."Das allerletzte Wort oder vielmehr der allerletzte Klang soll aber noch einmal Beethoven gehören: Hören Sie, wie unser kleines Thema am Schluss des Satzes in einer ihm unbekannten, neuen Trillerwelt versinkt, wieder auftaucht, sich zaghaft
– wie probeweise – fugiert und als großes Fragezeichen stehen bleibt.
stop telling stories!
Zur Entwicklung nicht-narrativer Strukturen im deutschsprachigen Musiktheater - ein Rückblick
auf das 20ste JahrhundertBerlin, im Juni 2001: Lovepangs - der Kongress der Liebeskranken. Die Wiener Konzeptkünstlerinnen Brucic und Müller veranstalten in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz ein multimediales Spektakel zum Thema "Liebeskrankheit in unserer Gesellschaft" - das Publikum ist eingeladen, die jeweils eigenen Liebesschmerz-Erfahrungen einzubringen und auszuagieren. An die hundert "Schmerzberater" (eine beeindruckend wilde Mischung von Repräsentanten aus Kunst, Politik und Gesellschaft- zum Beispiel Antje Vollmer, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, die Showgröße Zazie de Paris, Elmar Weingarten, Ex-Intendant der Berliner Philharmoniker, der Alt-68er-Kulturwissenschaftler Bazon Brock, Rainer Langhans, ehemals Kommune I, Dr. Motte, Organisator der Love-Parade.......) bieten "Therapiegespräche" in vier verschiedenen Rubriken an: analog zu vier vorgestellten Phasen der Verarbeitung von Liebesschmerz kann sich der leidende Besucher einwählen in die Kategorien PAIN (Schmerz), RAGE (Wut), RESENT (Ablehnung, Distanzgewinnung) und OVER (Reflexion vom Ende her) und sein Problem im Einzelgespräch oder öffentlich erörtern. Weiterhin fungieren Christoph Schlingensief und Alexander Kluge als Zeremonienmeister und Regisseure und animieren die liebeskranken Schäflein, ihren Schmerz und ihre Rachegelüste in grotesk oder schaurig improvisierten Opernszenen loszuwerden. Da fließt viel Theaterblut, es wird ausgiebig gesungen, geschrieen und gekleckert. Untermalt wird dieses "Theater des Schmerzes" von den großen Liebesarien der Opernliteratur: Mozart, Verdi, Puccini..... Auch der Kommerz kommt nicht zu kurz: man kann Lovepangs-Suppen und Lovepangs-Bier erwerben, damit dieses Opernerlebnis der anderen Art auch geschmacklich unverwechselbar in Erinnerung bleibt.
Alles passiert gleichzeitig, niemand überblickt das Ganze, das Prinzip zur Überwindung der traditionellen Opernästhetik heißt: Chaos. Alexander Kluge beschreibt das Projekt als "Imaginären Opernführer", in dem endlich jeder einzelne Besucher in seiner individuellen Oper die Hauptrolle spielt und nicht mehr zum andächtigen Zuschauen und Zuhören verdammt ist. Die traditionelle Opernmusik wird, als "Kraftwerk der Gefühle", benützt, um jedermanns Liebesschmerz-Geschichte in den Rang von "Kunst" zu erheben. Und Bazon Brock freut sich ergänzend, daß eine Denkkategorie aus den 60erJahren endlich wieder zu Ehren kommt: Kunst als "soziale Strategie".
Was wird hier gespielt? Ist es die radikale Demokratisierung des Prinzips Oper? Oder das Verebben des Genres in einer voyeuristischen Spaßgesellschaft ("Alles ist Oper!")? Oder nur eine ästhetische Sackgasse?Ich möchte hier versuchen (als Reflexion einiger persönlicher Wahrnehmungen aus deutschen Musiktheater-Aufführungen der letzten 15 Jahre), drei Begriffe zu umkreisen, die für die Kunst im 20sten Jahrhundert generell von großer Bedeutung waren, im Bereich der Opernproduktion aber zu besonders heftigen und nachhaltigen Diskussionen geführt haben. Es sind die Begriffe DEMOKRATIE, FRAGMENT und ZUFALL. Wie haben diese "Paßwörter" der Moderne in die Ästhetik des Musiktheaters hineingewirkt? Wo haben sie neue Erzählweisen generiert, wie haben sie das traditionelle Wertesystem der Oper infragegestellt?
"Demokratisierung" bedeutet immer "Abbau von Hierarchien", auch in der Kunst: Arnold Schönberg sah in der Formulierung seines Systems der "Komposition mit 12 nur aufeinander bezogenen Tönen" einen dezidiert demokratischen Impuls am Werk - jeder chromatische Wert sollte, von seinen Funktionen im hierarchischen tonalen System befreit, zu jedem anderen chromatischen Wert in freie intervallische Bezüge treten können. Allerdings hat Schönberg in seiner Musiktheater-Arbeit (bei der Oper "Moses und Aaron") sein eigenes System insofern relativiert, als er die Regeln der Zwölftontechnik so geschickt einsetzte, daß am Ende doch eine Musik entstand, die mit dem spätromantischen Operngeschmack kompatibel war. Auf Schönberg und Webern aufbauend, wurde nach dem zweiten Weltkrieg in der seriellen Musik das Diktum formuliert, daß nun sogar die Bausteine des einzelnen Tones (in der Musiktheorie ungeschickterweise "Parameter" genannt), nämlich Tonhöhe, Tondauer, Klangfarbe, Artikulation und Tonort frei und nach je eigenen Regeln gestaltet werden konnten . Wie man sich vorstellen kann, führte diese Entwicklung gerade in einem bisher so "melodievernarrten" Genre wie dem Musiktheater zu allerlei Verwerfungen und Spannungen. Schon in Alban Bergs "Lulu" löst sich der Widerspruch zwischen der traditionellen Dialogführung und der avancierten Melodiekomposition nicht richtig auf, und die meisten nach dem zweiten Weltkrieg komponierten Opern verlassen bei der Singstimmenbehandlung die strenge Theorie und machen Konzessionen an die "Theaterpraxis". Die Oper scheint den historischen Differenzierungsprozessen im musikalischen Material am meisten Widerstand entgegenzusetzen, sie beharrt auf den tradierten Erzählformen, die singende Theaterfigur sträubt sich offenbar gegen die Zerlegung der sie konstituierenden Elemente.
Mannheim, Ende der 80erJahre, in einer Aufführung der "Hamletmaschine" von Wolfgang Rihm (nach einem Theaterstück von Heiner Müller):
Das Orchester quillt aus dem Graben, es ist zu groß für das Mannheimer Theater, Schlagzeug und Blechbläser besetzen Teile der Bühne und des Zuschauerraums - in der Bühnenmitte steht die Sopranistin und singt sich die Seele aus dem Leib (ich habe vergessen, was sie sang, aber ihre Haltung und ihre Aura sind mir in eindrücklicher Erinnerung), ihr Innenleben ist der Brennpunkt des gesamten riesigen Theaterapparates, alle Scheinwerfer, Kulissen, Bühnenarbeiter und Maschinisten, sämtliche klingenden Hölzer, Rohre , Felle und Bleche und ihre dramatische Stimme dienen dem einzigen Zweck, die Intensität und Einmaligkeit ihrer Gefühle ins Publikum zu schleudern. Merkwürdiger Widerspruch: die Musik fährt alles auf, was das 20ste Jahrhundert an Geräusch- und Klangeffekten hervorgebracht hat, die Stimme meistert abenteuerliche atonale Sprünge - jedoch die Fokussierung auf die Sängerin und ihre Aura erfüllen alle Bedingungen des traditionellen Opernklischees. Es paßt nicht zusammen.Der demokratische Mensch ist ein Jedermann, ein blasser Vertreter der Spezies mit einem normalen Alltagsleben ohne große Höhen und Tiefen, es fehlt ihm eigentlich alles, was eine gelungene Opernfigur ausmacht: Hochmut, Mordlust, Intrigantentum, erotische Raserei.....Taugt der "durchschnittliche Bürger" überhaupt als Vorlage für ein Genre, das zum vorbildhaft Herausgehobenen, zum Exemplarischen neigt?
Berlin, 1995, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz: "Murx den Europäer! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn ab! - ein patriotischer Abend von Christoph Marthaler." Der Zuschauer betritt das Theater und sieht auf der Bühne - in einer Art heruntergekommenem Wartesaal - mehrere schlecht angezogene Statisten sitzen, die offensichtlich auf irgend etwas warten, und es passiert - nichts. Lange, lange Zeit passiert wirklich rein gar nichts. Der Zuschauer wird ungeduldig und denkt sich: jetzt könnten aber einmal die handelnden Figuren auftreten, da beginnen die Statisten ganz leise, leicht und wunderschön zu singen - und so kommt Marthalers böse und zugleich zärtliche Abrechnung mit dem europäischen (oder präziser: deutschen) Untertanencharakter ins Rollen. Und ganz allmählich wird der Zuschauer gewahr, daß die "Statisten" selbst die erwarteten Hauptfiguren sind, daß hier hochkarätige Schauspieler Statisten spielen, daß eine Gruppe von Bühnen-Mitarbeitern, die sonst immer unbeachtet am Rande (außerhalb des "Brennpunkts") agiert, durch diesen Kunstgriff listig in den Mittelpunkt gerückt wird. Und erstaunt beobachtet er, wie hier durch den Verzicht auf die fokussierenden Verfahrensweisen des üblichen Musiktheaters plötzlich die Figuren zu blühen beginnen, wie er von diesen neurotischen Verlierer-Figuren zutiefst fasziniert und berührt wird.Analog zu den anderen Künsten (z. B. bei Picasso die Auflösung der menschlichen Gestalt in Fragmente oder in dem frühen Berlin-Film "Sinfonie einer Großstadt" die Widerspiegelung des hektischen Lebensgefühls der jungen Metropole durch temporeiche Kameraführung und schnelle Schnitte) gibt es auch in der Musik der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts eine Tendenz zu immer weitergehender Fragmentierung des Materials und der musikalischen Formen. Die pointillistischen und extrem kurzen Werke Anton Weberns bilden einen ersten Höhepunkt in dieser Entwicklung. Parallel dazu schaffen die Emanzipation des Geräuschs als gültige musikalische Kategorie (vor allem bei Edgar Varèse) und die Vorstellung, daß mehrere klangliche Schichten oder auch Handlungsstränge gleichzeitig ablaufen können, neue Denkmöglichkeiten auch für das Musiktheater. Ein schönes frühes Beispiel ist die Wirtshausmusik in Alban Bergs "Wozzeck", wo alle möglichen Musiken im Kopf der trunkenen Hauptfigur "durcheinanderpurzeln". Eine ganz wichtige Figur für diesen Strang ist der 1970 aus dem Leben geschiedene Komponist Bernd Alois Zimmermann. In seiner Oper "Die Soldaten" nach dem Theaterstück von Jakob Michael Lenz collagiert er alte und neue Musikfetzen, ernste und populäre Genres und schmilzt daraus mit Hilfe eines überdimensionalen Orchesterapparates grandiose, schillernde Klanglandschaften. Die zugehörige Denkfigur nennt er die "Kugelgestalt der Zeit" - es gibt in der Musikgeschichte kein "früher" und "später" mehr, alle Musik aller Zeiten ist prinzipiell gleichzeitig präsent (wie auf der Oberfläche einer Kugel, wo die Distanz zur Mitte überall gleich ist), und der Komponist hat die Aufgabe, nach seinen eigenen Regeln Fragmente von dieser Oberfläche in den Brennpunkt (den Ort der schöpferischen Arbeit) zu zitieren. Allerdings ist auch hier anzumerken, daß die konventionelle Dramaturgie (es handelt sich trotz allem um eine "Literaturoper") seltsam quer zu der bahnbrechenden Musik steht.
Ausgehend von diesen Impulsen gibt es dann gegen Ende des Jahrhunderts mannigfaltige Versuche, die Idee der Gleichzeitigkeit verschiedener Schichten auch auf dramaturgischer Ebene umzusetzen: mehrere parallele Erzählebenen, Aufsplitterung der Figuren (z.B. ein Sänger, ein Tänzer und ein Schauspieler stellen gleichzeitig dieselbe Figur dar), Verzicht auf eine durchgehende "Geschichte"......Allerdings hat sich keiner dieser Kunstgriffe so richtig etabliert, auch hier scheint das Musiktheater renitent zu sein - es bleiben viele Fragen offen. Luigi Nono hat aus diesem Dilemma seine ganz eigene Konsequenz gezogen: in seinem großen Spätwerk "Prometeo" verzichtet er ganz auf die optische Ebene, er nennt das Stück eine "Tragödie des Hörens" (tragedia d¢ascolto), es ist vom Theater her gedacht, aber die dramatischen Vorgänge finden ausschließlich im Ohr statt.
Frankfurt am Main, Ende der 80erJahre: John Cage hat für Frankfurt eine Oper geschrieben(!) - "Europeras 1 + 2"; er hat Mittelstimmen aus urheberrechtlich nicht mehr geschützten Werken der Operngeschichte ("unbeachtetes Material") mit Hilfe eines zufallsgenerierten Computerprogramms durcheinandergeschüttelt, auch Lichteinstellungen, Kulissenbewegungen, Kostüme und Arien-Versatzstücke werden solchen Zufallsoperationen unterzogen, so daß es in den "Europeras" durchaus vorkommen kann, daß ein Tenor im Gärtner-Kostüm mit Wikingerhelm eine Sopranarie singt, während das Licht ganz woanders ist und sich ihm grade eine Kulisse vor die Nase schiebt. Diese radikale "Demokratisierung" der theatralischen Mittel, das freie Spiel der Elemente auf einer Theaterbühne hinterläßt einen verstörenden Eindruck, zu sehr ist man daran gewöhnt, daß sich alles sorgsam abgestimmt einem Gesamteindruck unterordnet. Die über Jahrhunderte gewachsenen Theatergesetze sind mit einem frechen Handstreich aus den Angeln gehoben, das Chaos und die Beliebigkeit haben die Herrschaft übernommen. Aber das Theater schlägt zurück: Die Sängerinnen und Sänger machen sich einen Jux daraus, sie retten sich in Parodien und Insider-Witze, und auf der untersten Ebene, der des Klamauks, gewinnt das alte Schlachtroß Theater mühelos gegen den experimentellen Ansatz.Ein anderer wichtiger Demokratisierungsimpuls kommt aus der Zeit der linken Studentenbewegungen in den 60er- und 70er-Jahren, am radikalsten formuliert von Joseph Beuys, der die gemeinsame Arbeit an der "sozialen Skulptur" zum ultimativen Ziel aller Kunstanstrengung erklärt; nicht mehr Farben, Materialien oder Klänge sollten die Mittel künstlerischer Gestaltung sein, sondern die Beziehungen der Menschen untereinander seien gemeinsam neu zu formen, um den Weg in eine bessere Gesellschaft zu ebnen. Sein "erweiterter Kunstbegriff" gipfelt in der Parole: "Jeder Mensch ist ein Künstler!". Auch "Schmerzberater" Bazon Brock's Stichwort von der Kunst als sozialer Strategie (siehe oben) kommt aus dieser Tradition, und vermutlich hätte Joseph Beuys der "Kongress der Liebeskranken" gut gefallen.
Frankfurt am Main, im Juni 2001: fünf jüngere Komponisten aus vier europäischen Ländern (Mark André, Régis Campo, Emanuele Casale, David Coleman und Jörg Widmann) haben Einakter für die Frankfurter Oper geschrieben. Sie werden an einem Abend unter dem Gesamttitel "five movements" mit dem Ensemble Modern als Klangapparat aufgeführt. So unterschiedlich die kompositorischen und dramaturgischen Herangehensweisen der fünf Komponisten auch sind, eines haben sie gemeinsam: alle beschreiben Menschen in auswegslosen Situationen. Tiefste Einsamkeit durch den Verlust des Gegenübers (Widmann), sinnlos repetierter Nonsense (Campo), tödlicher Zynismus (Coleman), finale Einbunkerung (Casale) und das orientierungslose Spiel als Abgrund (André) sind die Sujets, derer sie sich angenommen haben. Ist das ein Zeichen für den bodenlosen Pessimismus einer neuen Generation, oder bildet sich in diesen End-Spielen (Beckett läßt grüßen!) auch die Krise des Genres Oper als gültiges und vitales Reflexionsmedium der gesellschaftlichen Vorgänge ab?"Stop telling stories!" - dieser flapsige ästhetische Zwischenruf des amerikanischen Komponisten Norton Feldman bringt eine wichtige Neuerung in der Kunst des 20sten Jahrhunderts sehr schön auf den Punkt: dem "Geschichtenerzählen" der alten Art (von charismatischen Figuren wie Königen, Feen, Mördern und unglücklich Verliebten....) und den zugehörigen Bedeutungs-Fixierungen im künstlerischen Material wird der Versuch entgegengesetzt, die Mittel von eingefahrenen Wahrnehmungsmustern zu befreien, sie neuen Regeln zu unterwerfen und so im Material selbst eine Entsprechung zur Entwicklung der modernen Massengesellschaft zu formulieren. Was aber heißt das für die Oper? Was will die Oper sagen, wenn sie keine Geschichte erzählt? In der Tat scheint es so, daß die Oper diesen Tendenzen eine besondere Schwerkraft entgegensetzt, daß sie am meisten von allen Künsten an den alten Erzählweisen hängt, daß der singende Mensch auf der Bühne eine persönliche Identifikation des Zuschauers einfordert, die nur eintreten kann, wenn er sich öffnet, wenn er "etwas erzählt". Viele Komponisten umgehen dieses Problem, indem sie weiterhin ihre Erzählstrukturen von literarischen Vorlagen übernehmen, die "Literaturoper" gibt es nach wie vor, allerdings glaube ich nicht, daß sie einen wesentlichen Impuls für ein zukünftiges Musiktheater wird geben können. Man kommt nicht drumherum: Es bleiben ungelöste grundsätzliche Fragen, und in den letzten Jahrzehnten ist wenig ästhetisch wirklich Überzeugendes entstanden. Die krisenhafte Such- und Experimentierphase, die spätestens mit Bergs "Lulu" begonnen hat, dauert an. Es ist schwer zu beurteilen, ob und wie das Musiktheater eine Zukunft hat - Dr. Hans-Joachim Schaefer, der in über 40 Jahren als Chefdramaturg am Staatstheater Kassel zahlreiche Opernerstaufführungen ermöglicht und begleitet hat, ist ein unverbesserlicher Optimist: die Oper müsse sich wandeln, möglicherweise müßte sie wieder "ärmer" werden, um die Phantasie wieder in ihr Recht zu setzen, neue Möglichkeiten der Vermittlung für ein heutiges Publikum müssten gefunden werden, vielleicht würden die großen Opernhaus-Apparate unter dem zunehmenden finanziellen Druck zusammenbrechen....... aber das Genre an sich habe die Kraft, auch weiterhin die Herzen und Hirne der Menschen zu bewegen. Patrice Chereau (immerhin der Regisseur des Bayreuther "Jahrhundert-Rings") hat kürzlich in einem Interview erklärt, die Oper sei für ihn gestorben, er könne sich nicht vorstellen, daß in diesem Genre zeitgenössische Wirklichkeit noch sinnvoll abgebildet werden könne, er mache jetzt lieber Filme. Die Einladung von Pierre Boulez, mit ihm 2004 in Bayreuth den "Parsifal" zu machen, habe er - nicht ohne noch einmal in Versuchung gekommen zu sein, wie er bekennt - abgelehnt. Ironie der Geschichte: Vor 40 Jahren war es Boulez, der gefordert hatte, alle Opernhäuser in die Luft zu sprengen........
Reinhard Karger
Kassel 2001
Die Ekstase der Langsamkeit oder
Die Jungfer der Baronin Putbus
Versuch eines Musikers über Marcel ProustWie setzt sich ein Musiker mit einem Hauptwerk der europäischen Literatur auseinander? Zu dieser Frage hier einige Überlegungen des Komponisten selbst. Ergänzend dazu eine kurze Einführung in das Werk "la vie c'est ailleurs", in dem Konzert und Lesung ineinander verschränkt sind, ohne daß das traditionelle "Vertonungsprinzip" darauf verwendet wird. Beide Teile, Wort und Ton, zeigen unterschiedliche Zugänge zu Proust auf, die, auch wenn mit derselben Thematik beschäftigt, die Grenzen ihrer Gattung nicht überschreiten, sondern erst in der ihnen äußerlichen Zusammensetzung durch den Zuhörer zu einem gemeinsamen Ganzen werden. Aber auch für sich allein genommen, produziert der musikalische Part seine besondere Eigenspannung. Die Besetzung - Sopranstimme, zwei Altsaxophone, Posaune, Akkordeon, Violine und Kontrabaß - führt Instrumente zusammen, die sich in Struktur und Tonqualität fremd sind und den Komponisten Reinhard Karger vor die schwierige, aber von ihm bevorzugte Aufgabe stellen, eine genaue Balance zwischen ungleichen Klangquellen herzustellen.Wer sich die (in der deutschen Übersetzung) 4678 Seiten lange Erzählung "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" von Marcel Proust vornimmt, wird sehr bald an einen Scheideweg geführt: Entweder der Leser verbannt das Werk ziemlich bald (und dann meistens für immer) zurück in den Bücherschrank und - entnervt von riesigen Schachtelsatz-Konstruktionen, frustriert vom Auf-der-Stelle-Treten der Handlung und erschlagen von der Ausführlichkeit der Beschreibungen - wendet sich kurzweiligeren Stoffen zu. Oder er wird ergriffen vom Sog dieser Sprache, diesem geduldigen, spielerischen Umkreisen der Dinge und wird süchtig, kann über Monate oder Jahre gar nicht mehr ohne diesen "Stoff" auskommen.
Die provozierende Langsamkeit der Proustschen Erzählung scheidet die Geister und markiert ein Verfahren, das auch heute wieder, am Ende des 20. Jahrhunderts, Autoren und Komponisten fasziniert: der Verzicht auf die "spannend erzählte Geschichte" und der Verzicht auf klare Verhältnisse in Zeit und Raum, dafür das Hineinhorchen, Verweilen, geduldig bis in die feinsten Verästelungen eines Phänomens Eindringen, vom "Hölzchen" aufs "Stöckchen" Kommen, unvermittelt die Ebenen wechseln - ein Verfahren, das strukturell eher dem Traum zugehörig ist als dem wachen Erzählen.
In der jüngsten Vergangenheit verfolgten Komponisten wie Luigi Nono und Morton Feldman eine ähnliche Strategie:
Feldmans in den 80er Jahren entstandenes 2. Streichquartett dauert vier Stunden und zehn Minuten, ist durchgehend sehr leise zu spielen, und es passiert eigentlich nichts. Lapidare Floskeln werden wiederholt und variiert, immer wieder von langen Pausen durchsetzt - man hat beim Zuhören das Gefühl, daß die Zeit stillsteht. (Eine von Feldmans Parolen: "Stop telling stories!") Auch hier wird sich der Hörer sehr bald entscheiden:
Entweder er verläßt das Konzert, weil nichts "geboten" wird, oder er begibt sich hinein in die Magie dieses geduldigen Auslotens einer musikalischen Situation. Das Gemeinsame bei Proust und Feld man ist nicht, was erzählt wird, sondern der Wahrnehmungszustand, in den der Leser/Zuhörer versetzt wird; es scheint, daß jeweils das Ende einer Epoche (das Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts und unsere jetzige bürgerliche Endzeit) dieses Phänomen hervorbringt.
Der Ich-Erzähler in Prousts Geschichte (der viele Züge des historischen Marcel Proust in sich vereint) ist ein junger, kränkelnder Möchtegern-Schriftsteller, der nie irgend etwas aufs Papier bringt, meistens bei geschlossenen Fensterläden auf seinem Bett liegt (er kann das helle Sonnenlicht nicht ausstehen!) und sich durch seine Erinnerungen treiben läßt: ein Segler ohne Segel, ohne Kompaß und ohne Heimathafen, ein hypochondrischer Selbstbeobachter' der die Reflexe der eigenen Innenwelt auf längst vergangene Ereignisse seziert.
(Das Erstaunliche ist, daß diese " schwache Figur", diese willenlose Mimose sozusagen "unter der Hand" - indem sie ihr Scheitern im aktiven Leben beschreibt eines der größten Werke der Weltliteratur hervorbringt: psychologische Genauigkeit, strukturelle Kühnheit, beißender Spott, der weder die große Welt des Pariser fin-de-siecle noch sich selbst schont, und eine musikalische Sprache, die ihresgleichen sucht.)
In diesem Erinnerungsfeld sind die herkömmlichen Koordinaten von Zeit und Raum aufgehoben: Der Ich-Erzähler springt zwischen Personen, Ereignissen und Zeitschichten hin und her, die Erzählzeit steht fast still, wie Luftblasen tauchen die Bilder aus der Erinnerung auf und zerplatzen im Erzählen. Um aber all die flüchtigen Gestalten wahrnehmen zu können, die heraufsteigen, bedarf es der willenlosen, passiven Hingabe und gleichzeitig der konzentrierten Aufmerksamkeit, ein Paradoxon ähnlich dem von dem Komponisten John Gage postulierten " interesselosen Interesse"; und Proust zieht seinen Leser mit in den Zustand, der ihm seine erstaunlichen Wahrnehmungen geschenkt hat: die Ekstase der Langsamkeit.Die virtuelle GeliebteKennen Sie Kyoko Date, das Medien-Idol aus Japan, das Mädchen, das massenweise Liebesbriefe bekommt, Eifersuchtsszenen hervorruft und ziemlich viel Geld verdient? Kyoko gibt es gar nicht. Sie existiert nur auf dem Computerschirm, sie ist ein "Homunculus" der modernen Video-Designer und ruft doch die gleichen Reaktionen hervor wie eine Geliebte aus Fleisch und Blut. Die Unmöglichkeit der Vereinigung mit der Geliebten ist hier buchstäblich vorprogrammiert, ist Teil des Spiels. Auch bei Proust gibt es diese unüberschreitbare Grenze zwischen dem Liebenden und dem begehrten Objekt, sie ist jedoch nicht technischer, sondern geistiger Natur: Proust ist ein erotischer Pessimist. In der ganzen langen Geschichte gibt es keine erfüllte Liebe, der Ich-Erzähler vergeht vor Sehnsucht, wenn die Geliebte fern ist, sobald sie da ist, ist es ihm langweilig, und er sehnt sich nach einer Reise nach Venedig oder einem Museumsbesuch. Für ihn entstehen wahre und intensive Gefühle nur für das Bild der Geliebten, das seine Phantasie ausmalt, die wirkliche Begegnung bleibt immer hinter diesem Bild zurück. Die prägnanteste Figur in dieser Hinsicht ist die der Jungfer der Baronin Putbus. Dieses junge Mädchen - vom Jugendfreund als besonders attraktiv und willig empfohlen - wird immer wieder annonciert: Man hat gehört, die Baronin Putbus wolle in wenigen Tagen dasselbe Hotel beziehen, sie wolle in diesem oder jenem Salon erscheinen' oder sie nehme gewöhnlich den Abendzug ... Doch weder die Baronin noch ihre Jungfer tauchen jemals in der Geschichte auf, man erfährt rein gar nichts über sie' sie sind Phantome, sie existieren vielleicht gar nicht - was den Ich-Erzähler nicht davon abhält' bei Bedarf seine gesammelte erotische Energie auf die ferne Jungfer zu projizieren.
So wird auch hier eine merkwürdige Patenschaft sichtbar: Ein erotisches Phänomen, das wohl an Endzeiten von Epochen gekoppelt ist, schlägt die Brücke über ein Jahrhundert und berührt uns tiefer, als wir es aus der Feder eines "verstaubten Salonschriftstellers" je erwartet hätten. Hinzuweisen ist jedoch auch auf einen wichtigen Unterschied zwischen Kyoko Date und der Jungfer der Baronin Putbus: Bei Proust ersteht trotz der Unmöglichkeit der erotischen Erfüllung immerhin ein individuelles Bild der Geliebten, es hat zwar wenig mit der geliebten Person, aber viel mit dem Liebenden selbst zu tun' er leistet die Phantasie-Arbeit; Kyoko dagegen wird als fertiges Bild geliefert, sie ist die standardisierte Geliebte, der kleinste gemeinsame Nenner, die erotische Japanerin "an und für sich".
Das Schlußwort spricht ein Musiker, ein Mann, der von seinem Hintergrund und seinem Wollen her kaum ferner zu Proust hätte stehen können: der Komponist Hanns Eisler, der den Aufbau der DDR mitgestaltete und die DDR-Nationalhymne schrieb, ein kluger, unabhängiger Kopf, der seinen mit Lenin aufgewachsenen Schülern riet:
"Lesen Sie Proust!"Reinhard Karger
Kassel, im Juli 1997
Versuch eines Musikers über Marcel ProustWie setzt sich ein Musiker mit einem Hauptwerk der europäischen Literatur auseinander? Zu dieser Frage hier einige Überlegungen des Komponisten selbst. Ergänzend dazu eine kurze Einführung in das Werk "la vie c'est ailleurs", in dem Konzert und Lesung ineinander verschränkt sind, ohne daß das traditionelle "Vertonungsprinzip" darauf verwendet wird. Beide Teile, Wort und Ton, zeigen unterschiedliche Zugänge zu Proust auf, die, auch wenn mit derselben Thematik beschäftigt, die Grenzen ihrer Gattung nicht überschreiten, sondern erst in der ihnen äußerlichen Zusammensetzung durch den Zuhörer zu einem gemeinsamen Ganzen werden. Aber auch für sich allein genommen, produziert der musikalische Part seine besondere Eigenspannung. Die Besetzung - Sopranstimme, zwei Altsaxophone, Posaune, Akkordeon, Violine und Kontrabaß - führt Instrumente zusammen, die sich in Struktur und Tonqualität fremd sind und den Komponisten Reinhard Karger vor die schwierige, aber von ihm bevorzugte Aufgabe stellen, eine genaue Balance zwischen ungleichen Klangquellen herzustellen.Wer sich die (in der deutschen Übersetzung) 4678 Seiten lange Erzählung "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" von Marcel Proust vornimmt, wird sehr bald an einen Scheideweg geführt: Entweder der Leser verbannt das Werk ziemlich bald (und dann meistens für immer) zurück in den Bücherschrank und - entnervt von riesigen Schachtelsatz-Konstruktionen, frustriert vom Auf-der-Stelle-Treten der Handlung und erschlagen von der Ausführlichkeit der Beschreibungen - wendet sich kurzweiligeren Stoffen zu. Oder er wird ergriffen vom Sog dieser Sprache, diesem geduldigen, spielerischen Umkreisen der Dinge und wird süchtig, kann über Monate oder Jahre gar nicht mehr ohne diesen "Stoff" auskommen.
Die provozierende Langsamkeit der Proustschen Erzählung scheidet die Geister und markiert ein Verfahren, das auch heute wieder, am Ende des 20. Jahrhunderts, Autoren und Komponisten fasziniert: der Verzicht auf die "spannend erzählte Geschichte" und der Verzicht auf klare Verhältnisse in Zeit und Raum, dafür das Hineinhorchen, Verweilen, geduldig bis in die feinsten Verästelungen eines Phänomens Eindringen, vom "Hölzchen" aufs "Stöckchen" Kommen, unvermittelt die Ebenen wechseln - ein Verfahren, das strukturell eher dem Traum zugehörig ist als dem wachen Erzählen.
In der jüngsten Vergangenheit verfolgten Komponisten wie Luigi Nono und Morton Feldman eine ähnliche Strategie:
Feldmans in den 80er Jahren entstandenes 2. Streichquartett dauert vier Stunden und zehn Minuten, ist durchgehend sehr leise zu spielen, und es passiert eigentlich nichts. Lapidare Floskeln werden wiederholt und variiert, immer wieder von langen Pausen durchsetzt - man hat beim Zuhören das Gefühl, daß die Zeit stillsteht. (Eine von Feldmans Parolen: "Stop telling stories!") Auch hier wird sich der Hörer sehr bald entscheiden:
Entweder er verläßt das Konzert, weil nichts "geboten" wird, oder er begibt sich hinein in die Magie dieses geduldigen Auslotens einer musikalischen Situation. Das Gemeinsame bei Proust und Feld man ist nicht, was erzählt wird, sondern der Wahrnehmungszustand, in den der Leser/Zuhörer versetzt wird; es scheint, daß jeweils das Ende einer Epoche (das Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts und unsere jetzige bürgerliche Endzeit) dieses Phänomen hervorbringt.
Der Ich-Erzähler in Prousts Geschichte (der viele Züge des historischen Marcel Proust in sich vereint) ist ein junger, kränkelnder Möchtegern-Schriftsteller, der nie irgend etwas aufs Papier bringt, meistens bei geschlossenen Fensterläden auf seinem Bett liegt (er kann das helle Sonnenlicht nicht ausstehen!) und sich durch seine Erinnerungen treiben läßt: ein Segler ohne Segel, ohne Kompaß und ohne Heimathafen, ein hypochondrischer Selbstbeobachter' der die Reflexe der eigenen Innenwelt auf längst vergangene Ereignisse seziert.
(Das Erstaunliche ist, daß diese " schwache Figur", diese willenlose Mimose sozusagen "unter der Hand" - indem sie ihr Scheitern im aktiven Leben beschreibt eines der größten Werke der Weltliteratur hervorbringt: psychologische Genauigkeit, strukturelle Kühnheit, beißender Spott, der weder die große Welt des Pariser fin-de-siecle noch sich selbst schont, und eine musikalische Sprache, die ihresgleichen sucht.)
In diesem Erinnerungsfeld sind die herkömmlichen Koordinaten von Zeit und Raum aufgehoben: Der Ich-Erzähler springt zwischen Personen, Ereignissen und Zeitschichten hin und her, die Erzählzeit steht fast still, wie Luftblasen tauchen die Bilder aus der Erinnerung auf und zerplatzen im Erzählen. Um aber all die flüchtigen Gestalten wahrnehmen zu können, die heraufsteigen, bedarf es der willenlosen, passiven Hingabe und gleichzeitig der konzentrierten Aufmerksamkeit, ein Paradoxon ähnlich dem von dem Komponisten John Gage postulierten " interesselosen Interesse"; und Proust zieht seinen Leser mit in den Zustand, der ihm seine erstaunlichen Wahrnehmungen geschenkt hat: die Ekstase der Langsamkeit.Die virtuelle GeliebteKennen Sie Kyoko Date, das Medien-Idol aus Japan, das Mädchen, das massenweise Liebesbriefe bekommt, Eifersuchtsszenen hervorruft und ziemlich viel Geld verdient? Kyoko gibt es gar nicht. Sie existiert nur auf dem Computerschirm, sie ist ein "Homunculus" der modernen Video-Designer und ruft doch die gleichen Reaktionen hervor wie eine Geliebte aus Fleisch und Blut. Die Unmöglichkeit der Vereinigung mit der Geliebten ist hier buchstäblich vorprogrammiert, ist Teil des Spiels. Auch bei Proust gibt es diese unüberschreitbare Grenze zwischen dem Liebenden und dem begehrten Objekt, sie ist jedoch nicht technischer, sondern geistiger Natur: Proust ist ein erotischer Pessimist. In der ganzen langen Geschichte gibt es keine erfüllte Liebe, der Ich-Erzähler vergeht vor Sehnsucht, wenn die Geliebte fern ist, sobald sie da ist, ist es ihm langweilig, und er sehnt sich nach einer Reise nach Venedig oder einem Museumsbesuch. Für ihn entstehen wahre und intensive Gefühle nur für das Bild der Geliebten, das seine Phantasie ausmalt, die wirkliche Begegnung bleibt immer hinter diesem Bild zurück. Die prägnanteste Figur in dieser Hinsicht ist die der Jungfer der Baronin Putbus. Dieses junge Mädchen - vom Jugendfreund als besonders attraktiv und willig empfohlen - wird immer wieder annonciert: Man hat gehört, die Baronin Putbus wolle in wenigen Tagen dasselbe Hotel beziehen, sie wolle in diesem oder jenem Salon erscheinen' oder sie nehme gewöhnlich den Abendzug ... Doch weder die Baronin noch ihre Jungfer tauchen jemals in der Geschichte auf, man erfährt rein gar nichts über sie' sie sind Phantome, sie existieren vielleicht gar nicht - was den Ich-Erzähler nicht davon abhält' bei Bedarf seine gesammelte erotische Energie auf die ferne Jungfer zu projizieren.
So wird auch hier eine merkwürdige Patenschaft sichtbar: Ein erotisches Phänomen, das wohl an Endzeiten von Epochen gekoppelt ist, schlägt die Brücke über ein Jahrhundert und berührt uns tiefer, als wir es aus der Feder eines "verstaubten Salonschriftstellers" je erwartet hätten. Hinzuweisen ist jedoch auch auf einen wichtigen Unterschied zwischen Kyoko Date und der Jungfer der Baronin Putbus: Bei Proust ersteht trotz der Unmöglichkeit der erotischen Erfüllung immerhin ein individuelles Bild der Geliebten, es hat zwar wenig mit der geliebten Person, aber viel mit dem Liebenden selbst zu tun' er leistet die Phantasie-Arbeit; Kyoko dagegen wird als fertiges Bild geliefert, sie ist die standardisierte Geliebte, der kleinste gemeinsame Nenner, die erotische Japanerin "an und für sich".
Das Schlußwort spricht ein Musiker, ein Mann, der von seinem Hintergrund und seinem Wollen her kaum ferner zu Proust hätte stehen können: der Komponist Hanns Eisler, der den Aufbau der DDR mitgestaltete und die DDR-Nationalhymne schrieb, ein kluger, unabhängiger Kopf, der seinen mit Lenin aufgewachsenen Schülern riet:
"Lesen Sie Proust!"Reinhard Karger
Kassel, im Juli 1997
DER KOMPONIST
- ein Fossil im MedienzeitalterDER KOMPONIST -
Prototyp des versponnen, wirklichkeitsfernen, nur seiner Kunst lebenden Künstlers. Belächelt ob seiner Unfähigkeit, mit dem Alltag umzugehen, bewundert ob seines direkten Drahtes zu den Musen und zur Unsterblichkeit - dieses Bild beherrscht nach wie vor die öffentliche Meinung und die meisten Komponistenhirne. In jedem zeitgenössischen Komponisten steckt ein kleiner Beethoven, der sich in heldenhaftem Kampf zur ureigenen, unverwechselbaren Kunstsprache durchringen will.Parallel zur Herausbildung der Vorstellung vom »autonomen Kunstwerk«, die sich vom späten 18. bis hinein ins 20.Jahrhundert radikalisierte, bezog sich dieser Kampf immer ausschließlicher auf die immanente Weiterentwicklung des musikalischen Materials, DER KOMPONIST war immer mehr nur sich selbst verantwortlich, er koppelte sich ab von den sozialen Bindungen, die ihm in früheren Zeiten Sicherheit und Sinn gegeben hatten (Kirche, Fürstenhöfe). Diese Vorstellung, musikalischer Fortschritt sei nur durch die Weiterentwicklung innermusikalischer Kategorien erzielbar, die sich durch die zwei Jahrhunderte des bürgerlichen Zeitalters hindurch präzisierte und die noch 1958 bei Adorno den Maßstab lieferte für seine Polemik gegen Strawinsky und seine Bevorzugung Schönbergs (siehe »Philosophie der neuen Musik« von Th. W Adorno), steckt jedoch heute in einer tiefen Krise, und mit ihr DER KOMPONIST, sein Berufsbild, sein Selbstverständnis. Sein eifriges Forschen nach neuen Klangfarben, Obertönen, Mikrointervallen, komplexen Rhythmen und ungewöhnlichen formalen Lösungen wird unheilvoll kontrastiert durch das Wetterleuchten der globalen sozialen und ökologischen Katastrophen, das allabendlich mit den Fernsehnachrichten in seine Stube flimmert. Schmerzhaft stellt sich ihm die Frage nach dem Sinn seines stetigen, differenzierten Bemühens.DER KOMPONIST als geistiges Kind des bürgerlichen Kunstbegriffs (der sich zur Zeit Hölderlins und Beethovens - beide sind 1770 geboren
- herausbildete und der damals die revolutionäre Sprengkraft der Behauptung der Freiheit des Individuums besaß) sieht sich in einer Welt, in der seine Produkte fundamental anders rezipiert werden als zu der Zeit der Entstehung seines Selbstverständnisses. Der Beethovensche Anspruch, für alle Menschen und für alle Zeiten zu komponieren, ist heute an den Rand der Lächerlichkeit geraten. Die »originären« Kunstsprachen der vielen Komponisten in der heutigen Zeit degenerieren im Medienzeitalter zu bloßen Privatphilosophien, »provokative« Neuerungen im musikalischen Material haben jede Sprengkraft verloren und werden spielend als noch eine Farbe ins bunte Kaleidoskop der Freizeitkultur integriert. Der humanistische Anspruch, Menschen zu bewegen und zu bilden, verschwindet immer mehr hinter der Forderung, Menschen zu unterhalten, die »originären« Schöpfungen der Komponisten - der toten wie der lebenden - sind längst zur Ware mit kalkulierbarem Marktwert verkommen.So sieht sich DER KOMPONIST in einer Schwellensituation: Ohnmächtig sieht er zu, wie seine Schöpfungen entweder ignoriert oder zu kosmetischen Tupfern umgewandelt werden, die dem immer mehr von Großunternehmen gesponsorten Kulturbetrieb seine Toleranz und Offenheit gegenüber allem Neuen beweisen sollen. Die Vermarktungsmechanismen von Musik sind von ganz anderen Geistern inspiriert als der Prozeß des Komponierens. Nimmt DER KOMPONIST diese Beobachtungen ernst und stellt sich der existentiellen Bedrohung seines Handwerks, anstatt weiterhin blindlings Werk für Werk sein »Oeuvre« zu vervollständigen, so bleibt ihm zunächst nur: Sprachlosigkeit.All die über Jahrhunderte angereicherten differenzierten Fähigkeiten und Kenntnisse ihres Sinns beraubt zu sehen, kommt einem Tode gleich, es ist ein Verlust der Sprache. Diesen Verlust begleitet ein tiefes Mißtrauen gegen die erlernten Kunstgriffe und Effekte: kalkulierte Expressivität, elegante Instrumentation, raffinierte Gestaltbildung scheinen nicht mehr tauglich, um Wahrheit zu vermitteln.Die Not der Sprachlosigkeit wird zur Notwendigkeit, sich Fragestellungen zuzuwenden, die nicht mehr nur innermusikalisch lösbar sind; die sozialen Bedingungen des eigenen Tuns zu beobachten, die Gestaltungswut des sich selbst verwirklichenden Individuums zurückzunehmen und die Zusammenhänge ins Blickfeld zu rücken, in denen das eigene Leben und Werk steht.Warum macht wer Musik?
Was erzählen Menschen über sich, wenn sie singen?
Wie müßte eine Musik beschaffen sein, die sich strukturell den Gesetzen der Vermarktung entzieht; wie könnten ihre Entstehungsbedingungen aussehen?Solche Fragen gehören heute mit zum Arbeitsfeld des Komponisten, die Aufmerksamkeit verlagert sich von der Ebene der Organisation der musikalischen Bausteine zur Ebene der Zusammenhänge, in denen musikalische Phänomene entstehen und wirken. Der Musikbegriff erweitert sich in das soziale Feld hinein, und bindet sich dadurch wieder an die Menschen an, DER KOMPONIST wird vom utopischen Vordenker zur Hebamme. Jeder Mensch ist aufgefordert, am sozialen Geflecht musikalisch mitzugestalten, in allen Lebensbereichen klingende und nicht-klingende Musik zu hören und zu machen - Musik der Sprache, Musik des Wirtschaftskreislaufs, Musik der Arbeit, Musik der häuslichen Sphäre, Musik des Denkens, Musik der Stille... -, das ganze Leben kann als das Feld der Kunst begriffen und so differenziert gestaltet werden wie früher die Klänge und Rhythmen. Durch diese Anbindung an das reale Leben könnten auch klingende Phänomene (traditionellerweise »Musik« genannt) wieder einen authentischen Sinn bekommen als Kommunikationsmedium zwischen gleichberechtigten Menschen. Die Rolle des Komponisten wandelt sich in einem solchen Musikverständnis zu der des Beobachters und Anregers der kreativen Prozesse im sozialen Feld; er muß Abschied nehmen von der Vorstellung, er könne sich alleine zu immer neuen »Meisterwerken« durchkämpfen und dadurch Meilensteine setzen.»Diesen Kuß der ganzen Welt« - das Pathos der Beethoven'schen Umarmungsgeste ist nach wie vor verführerisch, die Vorstellung für den ganzen Planeten und für die Ewigkeit zu schreiben, ist Balsam fürs Ego, doch wenn DER KOMPONIST stirbt, wenn er es schafft, den Tod der eigenen Sprache anzunehmen und sich auf die Suche nach einem neuen Selbstverständnis macht, wird er vielleicht überleben können aber er wird verwandelt sein, er wird nicht mehr DER KOMPONIST sein.Reinhard Karger
Kassel, 15. Dezember 1988
Versuch eines Musikers über Marcel ProustWie setzt sich ein Musiker mit einem Hauptwerk der europäischen Literatur auseinander? Zu dieser Frage hier einige Überlegungen des Komponisten selbst. Ergänzend dazu eine kurze Einführung in das Werk "la vie c'est ailleurs", in dem Konzert und Lesung ineinander verschränkt sind, ohne daß das traditionelle "Vertonungsprinzip" darauf verwendet wird. Beide Teile, Wort und Ton, zeigen unterschiedliche Zugänge zu Proust auf, die, auch wenn mit derselben Thematik beschäftigt, die Grenzen ihrer Gattung nicht überschreiten, sondern erst in der ihnen äußerlichen Zusammensetzung durch den Zuhörer zu einem gemeinsamen Ganzen werden. Aber auch für sich allein genommen, produziert der musikalische Part seine besondere Eigenspannung. Die Besetzung - Sopranstimme, zwei Altsaxophone, Posaune, Akkordeon, Violine und Kontrabaß - führt Instrumente zusammen, die sich in Struktur und Tonqualität fremd sind und den Komponisten Reinhard Karger vor die schwierige, aber von ihm bevorzugte Aufgabe stellen, eine genaue Balance zwischen ungleichen Klangquellen herzustellen.Wer sich die (in der deutschen Übersetzung) 4678 Seiten lange Erzählung "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" von Marcel Proust vornimmt, wird sehr bald an einen Scheideweg geführt: Entweder der Leser verbannt das Werk ziemlich bald (und dann meistens für immer) zurück in den Bücherschrank und - entnervt von riesigen Schachtelsatz-Konstruktionen, frustriert vom Auf-der-Stelle-Treten der Handlung und erschlagen von der Ausführlichkeit der Beschreibungen - wendet sich kurzweiligeren Stoffen zu. Oder er wird ergriffen vom Sog dieser Sprache, diesem geduldigen, spielerischen Umkreisen der Dinge und wird süchtig, kann über Monate oder Jahre gar nicht mehr ohne diesen "Stoff" auskommen.
Die provozierende Langsamkeit der Proustschen Erzählung scheidet die Geister und markiert ein Verfahren, das auch heute wieder, am Ende des 20. Jahrhunderts, Autoren und Komponisten fasziniert: der Verzicht auf die "spannend erzählte Geschichte" und der Verzicht auf klare Verhältnisse in Zeit und Raum, dafür das Hineinhorchen, Verweilen, geduldig bis in die feinsten Verästelungen eines Phänomens Eindringen, vom "Hölzchen" aufs "Stöckchen" Kommen, unvermittelt die Ebenen wechseln - ein Verfahren, das strukturell eher dem Traum zugehörig ist als dem wachen Erzählen.
In der jüngsten Vergangenheit verfolgten Komponisten wie Luigi Nono und Morton Feldman eine ähnliche Strategie:
Feldmans in den 80er Jahren entstandenes 2. Streichquartett dauert vier Stunden und zehn Minuten, ist durchgehend sehr leise zu spielen, und es passiert eigentlich nichts. Lapidare Floskeln werden wiederholt und variiert, immer wieder von langen Pausen durchsetzt - man hat beim Zuhören das Gefühl, daß die Zeit stillsteht. (Eine von Feldmans Parolen: "Stop telling stories!") Auch hier wird sich der Hörer sehr bald entscheiden:
Entweder er verläßt das Konzert, weil nichts "geboten" wird, oder er begibt sich hinein in die Magie dieses geduldigen Auslotens einer musikalischen Situation. Das Gemeinsame bei Proust und Feld man ist nicht, was erzählt wird, sondern der Wahrnehmungszustand, in den der Leser/Zuhörer versetzt wird; es scheint, daß jeweils das Ende einer Epoche (das Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts und unsere jetzige bürgerliche Endzeit) dieses Phänomen hervorbringt.
Der Ich-Erzähler in Prousts Geschichte (der viele Züge des historischen Marcel Proust in sich vereint) ist ein junger, kränkelnder Möchtegern-Schriftsteller, der nie irgend etwas aufs Papier bringt, meistens bei geschlossenen Fensterläden auf seinem Bett liegt (er kann das helle Sonnenlicht nicht ausstehen!) und sich durch seine Erinnerungen treiben läßt: ein Segler ohne Segel, ohne Kompaß und ohne Heimathafen, ein hypochondrischer Selbstbeobachter' der die Reflexe der eigenen Innenwelt auf längst vergangene Ereignisse seziert.
(Das Erstaunliche ist, daß diese " schwache Figur", diese willenlose Mimose sozusagen "unter der Hand" - indem sie ihr Scheitern im aktiven Leben beschreibt eines der größten Werke der Weltliteratur hervorbringt: psychologische Genauigkeit, strukturelle Kühnheit, beißender Spott, der weder die große Welt des Pariser fin-de-siecle noch sich selbst schont, und eine musikalische Sprache, die ihresgleichen sucht.)
In diesem Erinnerungsfeld sind die herkömmlichen Koordinaten von Zeit und Raum aufgehoben: Der Ich-Erzähler springt zwischen Personen, Ereignissen und Zeitschichten hin und her, die Erzählzeit steht fast still, wie Luftblasen tauchen die Bilder aus der Erinnerung auf und zerplatzen im Erzählen. Um aber all die flüchtigen Gestalten wahrnehmen zu können, die heraufsteigen, bedarf es der willenlosen, passiven Hingabe und gleichzeitig der konzentrierten Aufmerksamkeit, ein Paradoxon ähnlich dem von dem Komponisten John Gage postulierten " interesselosen Interesse"; und Proust zieht seinen Leser mit in den Zustand, der ihm seine erstaunlichen Wahrnehmungen geschenkt hat: die Ekstase der Langsamkeit.Die virtuelle GeliebteKennen Sie Kyoko Date, das Medien-Idol aus Japan, das Mädchen, das massenweise Liebesbriefe bekommt, Eifersuchtsszenen hervorruft und ziemlich viel Geld verdient? Kyoko gibt es gar nicht. Sie existiert nur auf dem Computerschirm, sie ist ein "Homunculus" der modernen Video-Designer und ruft doch die gleichen Reaktionen hervor wie eine Geliebte aus Fleisch und Blut. Die Unmöglichkeit der Vereinigung mit der Geliebten ist hier buchstäblich vorprogrammiert, ist Teil des Spiels. Auch bei Proust gibt es diese unüberschreitbare Grenze zwischen dem Liebenden und dem begehrten Objekt, sie ist jedoch nicht technischer, sondern geistiger Natur: Proust ist ein erotischer Pessimist. In der ganzen langen Geschichte gibt es keine erfüllte Liebe, der Ich-Erzähler vergeht vor Sehnsucht, wenn die Geliebte fern ist, sobald sie da ist, ist es ihm langweilig, und er sehnt sich nach einer Reise nach Venedig oder einem Museumsbesuch. Für ihn entstehen wahre und intensive Gefühle nur für das Bild der Geliebten, das seine Phantasie ausmalt, die wirkliche Begegnung bleibt immer hinter diesem Bild zurück. Die prägnanteste Figur in dieser Hinsicht ist die der Jungfer der Baronin Putbus. Dieses junge Mädchen - vom Jugendfreund als besonders attraktiv und willig empfohlen - wird immer wieder annonciert: Man hat gehört, die Baronin Putbus wolle in wenigen Tagen dasselbe Hotel beziehen, sie wolle in diesem oder jenem Salon erscheinen' oder sie nehme gewöhnlich den Abendzug ... Doch weder die Baronin noch ihre Jungfer tauchen jemals in der Geschichte auf, man erfährt rein gar nichts über sie' sie sind Phantome, sie existieren vielleicht gar nicht - was den Ich-Erzähler nicht davon abhält' bei Bedarf seine gesammelte erotische Energie auf die ferne Jungfer zu projizieren.
So wird auch hier eine merkwürdige Patenschaft sichtbar: Ein erotisches Phänomen, das wohl an Endzeiten von Epochen gekoppelt ist, schlägt die Brücke über ein Jahrhundert und berührt uns tiefer, als wir es aus der Feder eines "verstaubten Salonschriftstellers" je erwartet hätten. Hinzuweisen ist jedoch auch auf einen wichtigen Unterschied zwischen Kyoko Date und der Jungfer der Baronin Putbus: Bei Proust ersteht trotz der Unmöglichkeit der erotischen Erfüllung immerhin ein individuelles Bild der Geliebten, es hat zwar wenig mit der geliebten Person, aber viel mit dem Liebenden selbst zu tun' er leistet die Phantasie-Arbeit; Kyoko dagegen wird als fertiges Bild geliefert, sie ist die standardisierte Geliebte, der kleinste gemeinsame Nenner, die erotische Japanerin "an und für sich".
Das Schlußwort spricht ein Musiker, ein Mann, der von seinem Hintergrund und seinem Wollen her kaum ferner zu Proust hätte stehen können: der Komponist Hanns Eisler, der den Aufbau der DDR mitgestaltete und die DDR-Nationalhymne schrieb, ein kluger, unabhängiger Kopf, der seinen mit Lenin aufgewachsenen Schülern riet:
"Lesen Sie Proust!"Reinhard Karger
Kassel, im Juli 1997
Biography
1953 born on May 3rd in Tübingen / Baden-Württemberg1972 Abitur at Albert-Einstein-Gymnasium Böblingen1972–77 composition studies with Prof. Erhard Karkoschka at Musikhochschule Stuttgart1974–75 studies in electronic music at "Instituut voor Sonologie" in Utrecht/Netherlands with Gottfried Michael Koenig1977–78 studies in music and theatre at
"California Institute of the Arts" Los Angeles/USA
(composition with Morton Subotnick, indian music, courses in theatre acting and directing, conducting, gamelan dance and Tai Ch'i)1978 title "Master of Fine Arts"1979–83 postgradual composition studies with Brian Ferneyhough at Musikhochschule Freiburg/Br.1972–80 scolarship holder of "Studienstiftung des deutschen Volkes"1980 composition award by Wilfried-Steinbrenner-Stiftung Berlin1985 composition award by Landeshauptstadt Stuttgart1985–87 director of theatre music at Staatstheater Kassel1987–2005 freelance composer and theatre director1990 co-founder of
"Musikzentrum im Kutscherhaus" in Kassel1994–2005 lectures and projects in contemporary music
at GhK Universität KasselSS 2000 guest lectures in composition at the conservatory in Göteborg (Sweden)SS 2001 guest lectures at Folkwang-Hochschule Essen2001 author for the art magazine ARTES (Stockholm)since 2004 member of the advisory council of Dr-Wolfgang-Zippel-Stiftung, Kassel2004 culture award of the city of Kassel
(together with Verena Joos)2005–2008 professor for contemporary music and projects at Universität Kassel2006–2009 artistic director of the concert series
"soundcheck im Eulensaal ", Kassel2007–2019 Univ.-Prof. in composition at University of Music and Performing Arts Vienna2011–2013 Dean of the institute for composition and electroacoustics at the University of Music and Performing Arts Viennasince 2012 Concerts, lectures, master classes and workshops in Sofia (Bulgaria), Shanghai (China), Hsinchu and Taipei (Taiwan), Poznan (Poland), Freiburg (Germany), Gran Canaria und Teneriffa (Spane), Weimar (Germany) and Bratislava (Slowakia)Among others, Kargers works are performed by
Ensemble Modern (Frankfurt),
Ensemble Recherche (Freiburg),
Nieuw Ensemble (Amsterdam),
Kasseler VocalensembleReinhard Karger lives as a composer and director
in Vienna together with the author and journalist Verena Joos
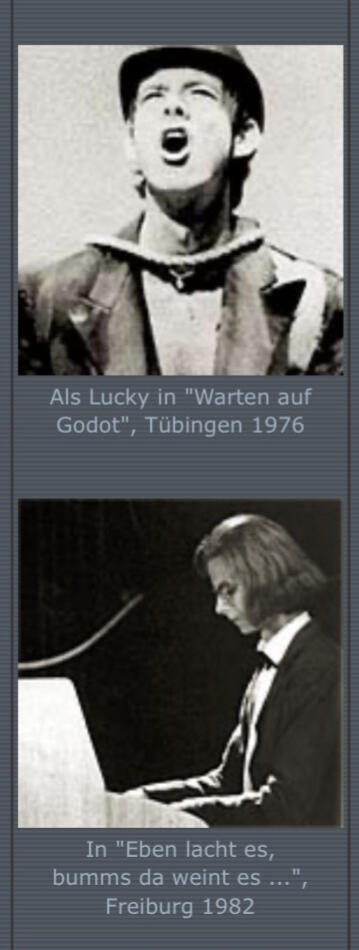
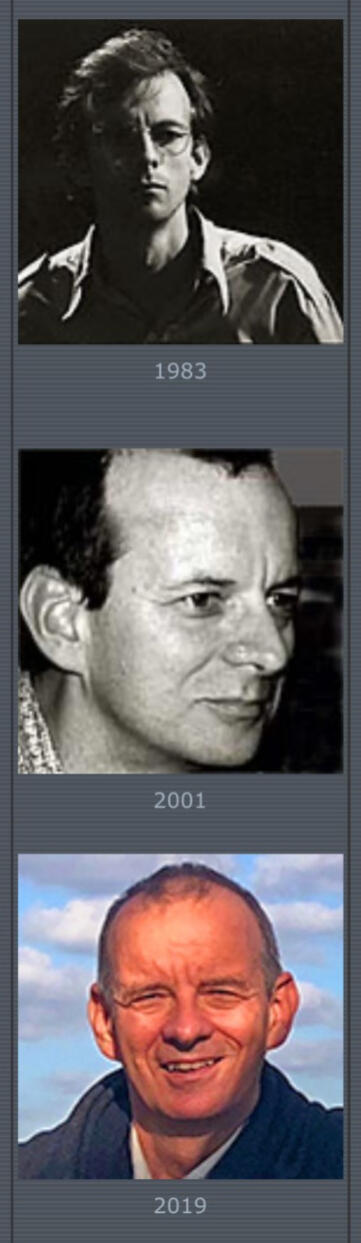
Biografie
1953 am 3. Mai geboren in Tübingen / Baden-Württemberg1972 Abitur am Albert-Einstein-Gymnasium Böblingen1972–77 Kompositionsstudium bei Prof. Erhard Karkoschka an der Musikhochschule Stuttgart1974/75 Spezialausbildung in elektronischer Musik am "Instituut voor Sonologie" in Utrecht/Holland bei Gottfried Michael Koenig1977/78 Theater- und Musikstudium am
"California Institute of the Arts" in Los Angeles/USA
( Komposition bei Morton Subotnick, außerdem indische Musik, Schauspiel- und Regiekurse, Dirigieren, Gamelan-Tanz und Tai Ch'i )1978 Titel "Master of Fine Arts"1979–83 Aufbaustudium Komposition bei Brian Ferneyhough an der Musikhochschule Freiburg/Br.1972–80 Stipendiat der "Studienstiftung des deutschen Volkes"1980 Förderpreis der Wilfried-Steinbrenner-Stiftung Berlin1985 Kompositionspreis der Landeshauptstadt Stuttgart1985–87 Leiter der Schauspielmusik am Staatstheater Kassel1987–2005 freier Komponist und Musiker in Kassel1990 Mitgründer der freien Musikschule
"Musikzentrum im Kutscherhaus" Kassel1994–2005 Lehrbeauftragter an der Fachrichtung Musik
der GhK Universität KasselSS 2000 Gastdozent für Komposition an der Musikhochschule GöteborgSS 2001 Lehrauftrag an der Folkwang-Hochschule Essen2001 Autorentätigkeit für das Kunstmagazin ARTES (Stockholm)2004–2009
im Beirat der Dr-Wolfgang-Zippel-Stiftung, Kassel2004 Kulturförderpreis der Stadt Kassel
(zusammen mit Verena Joos)2005–2008 Professor für zeitgenössische Musik und Projektarbeit
an der Universität Kassel2006–2009 Künstlerischer Leiter der Konzertreihe
"soundcheck im Eulensaal ", Kassel2007/08
Gastprofessur für Komposition
an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien2008–2019 Professor für Komposition mit Schwerpunkt Medienkomposition
an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien2011–2013 Institutsvorstand im Institut für Komposition und Elektroakustik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien2012 ERASMUS-Lehrtätigkeit in Sofia (Bulgarien)seit 2013 Konzerte, Gastvorträge, Masterclasses und Workshops in
Poznan (Polen), Freiburg im Breisgau (Deutschland), Shanghai (China), Hsinchu und Taipeh (Taiwan), Gran Canaria und Teneriffa (Spanien), Weimar (Deutschland) und Bratislava (Slowakei)Kargers Werke werden aufgeführt u.a. von
Ensemble Modern (Frankfurt),
Ensemble Recherche (Freiburg),
Nieuw Ensemble (Amsterdam),
Kasseler VocalensembleReinhard Karger lebt als Komponist und Regisseur zusammen mit der Autorin und Journalistin Verena Joos in WienStand: 01/2020
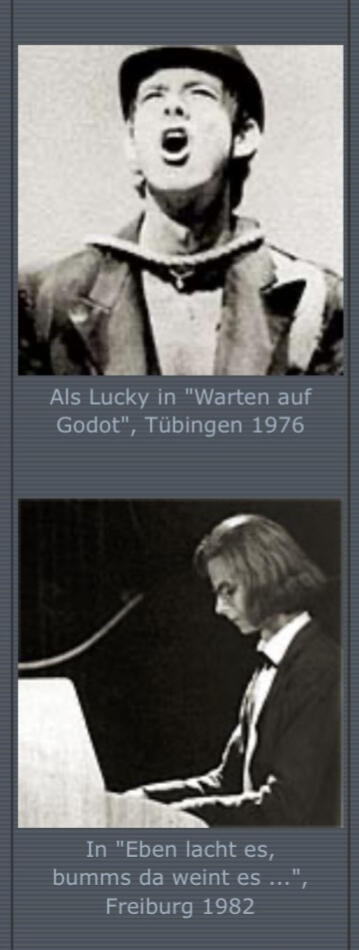
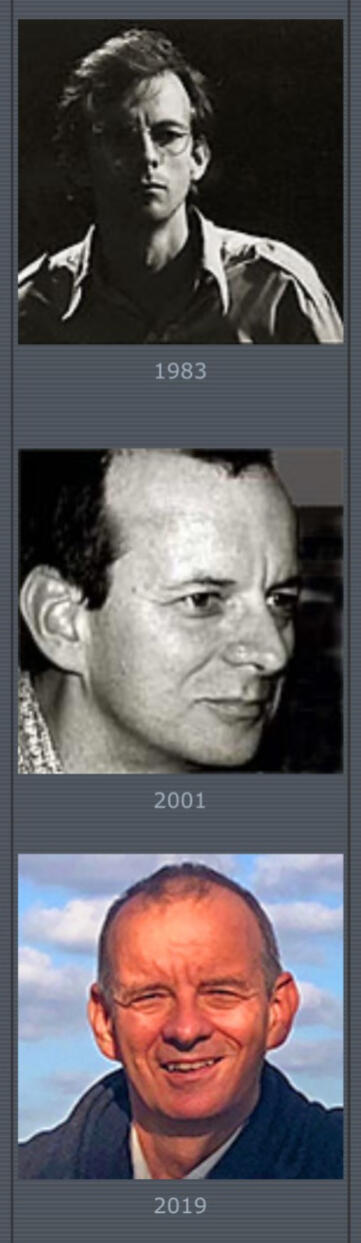
Contacts

For further information, questions or comments please write me an email!You can purchase the scores of my music via the online-publisher
BabelScores in Paris.
Reinhard KargerProfessor für Komposition mit Schwerpunkt Medienkomposition
an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien
privat: Untere Weißgerberstraße 45 – 1030 Wien
© 2002–15 für diese Site und die Musikbeispiele bei Reinhard Karger
© für die Fotos / Texte bei den Autoren
Besonderen Dank an den Fotografen Thomas Huther, Kassel,
der ein Großteil der verwendeten Fotos zur Verfügung stellte:
Impressum/Verantwortlich für diese Website im Sinne des § 6 TDG ist:
Reinhard Karger – Untere Weißgerberstraße 45 – 1030 WienHaftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung
für die Inhalte externer Links.
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Kontakt

Für weitergehende Informationen, Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte per Mail an mich. Die Noten der Kompositionen und vielfach auch Tonaufnahmen liegen vor und können angefragt werden.
Reinhard KargerProfessor für Komposition mit Schwerpunkt Medienkomposition
an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien
privat: Untere Weißgerberstraße 45 – 1030 Wien
© 2002–15 für diese Site und die Musikbeispiele bei Reinhard Karger
© für die Fotos / Texte bei den Autoren
Besonderen Dank an den Fotografen Thomas Huther, Kassel,
der ein Großteil der verwendeten Fotos zur Verfügung stellte:
Impressum/Verantwortlich für diese Website im Sinne des § 6 TDG ist:
Reinhard Karger – Untere Weißgerberstraße 45 – 1030 WienHaftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung
für die Inhalte externer Links.
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.